Br. Tilbert Moser proposes a biblical alternative to the Two-State Solution and Vatican recognition of the Palestinian State. This article is currently available in German only.
Die biblische Alternative zur Zweistaatenlösung
Eine Antwort auf den Vorstoss des Vatikan
Br. Tilbert Moser, Kapuziner, 25.10.15; 6. erw. Aufl.
Kapuzinerkloster, CH-4601 Olten
1.1. Die Bibel als „road map zum Frieden“?
3. Bedenkenswertes aus der Vorgeschichte
4. Die Verhaftung an die „Enterbungstheologie“ verhindert den Brückenbau zu den Juden
5. Das klare Bekenntnis von Heinrich Spaemann
6. Zionismus zum Segen für die Araber?
6.1. Zionismus als Katastrophe für die Palästinenser? Zum Beitrag von Ari Shavit
7.1. Die umstrittene „Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem“
8. Arabisches Unverständnis für die jüdische Sonderberufung
9. Der melkitische Patriarch Gregorios III.
10. Das jüdische Stigma der Auserwählung
11. Realistisch beide Seiten abwägen
12. Ephraim Karsh: die Palästinenser von den Arabern verraten
13. Einer, der sich auskennt: Johannes Gerloff
14. Das Leitbild der Völkerwallfahrt bei Jesaja
16. „Bekehrung zu Israel“ notwendig
17. Der in der messianischen Bewegung neu aufblühende Feigenbaum
18. Die Lehre aus der Nahostsynode
18.1. Pfingstliches Endzeitfieber als ökumenischer Stachel – die verkannte Eschatologie
19. Appell an die Kirchenverantwortlichen nicht nur im Vatikan
20. Der Ruf nach einer neuen Bewegung von „Freunden Israels“ („Amici Israel“)
21. Unmöglichkeit der Zweistaatenlösung
22. Biblische Leitbilder zum Abschluss
Der vorliegende Aufruf geht nicht nur an die Kirchenverantwortlichen, sondern an alle, die am Friedensplan Gottes im Nahostkonflikt mitwirken möchten und sich nicht von der Weltmeinung verführen lassen. Meine Ausführungen sind bruchstückhaft, nicht systematisch geordnet. Gerne nehme ich mit Dank Ergänzungen und Fragen entgegen. Fortlaufend habe ich wertvolle Zuschriften und Korrekturen hineinverarbeitet.
Ich widme diese Arbeit der jüdischen Mutter Marjam, die von ihrem Sohn, dem Messias Israels und Heiland der Völker, vom Kreuz herab beauftragt wurde, alle Menschen mütterlich an seinem Tisch zu vereinen.
1. Um was es geht
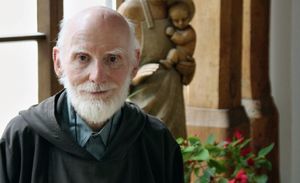
Der Vatikan versucht mit seiner Politik seit Jahren bei diesem Bemühen in der Hoffnung auf Frieden mitzuwirken. Seit 2000 verhandeln die Vatikandiplomaten unter Erzbischof Paul Richard Gallagher anhand von Prinzipienerklärungen mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) unter dem Aussenminister Riad Al-Maliki, was zum Grundlagenlagenvertrag führte, der beiderseits am 26. Juni 2015 unterschrieben wurde. Der Erzbischof gibt in seiner Ansprache der Hoffnung Ausdruck, dass das Abkommen einen Anstoss bilde, „den lange andauernden israelisch-palästinensischen Konflikt, der weiterhin auf beiden Seiten Leiden verursacht, in definitiver Weise zu beenden.“ Er hoffe, dass Palästina bald international als selbständiger Staat anerkannt wird.
Wir möchten den guten Willen beider Parteien, zum Frieden beizutragen, nicht bezweifeln. Der Vertrag „verkörpert unsere gemeinsamen Werte von Freiheit, Würde, Toleranz, von Koexistenz und Gleichheit aller…, in einem Moment, in dem Extremismus, barbarische Gewalt und Ignoranz das soziale Geflecht und die kulturelle Identität der Region und des menschlichen Erbes bedrohen“ , wie Aussenminister Al-Maliki sagte.
Doch dieser gut gemeinte, lang vorbereitete „Vorstoss“, hat bei vielen Kopfschütteln und Widerspruch erregt. Sie denken an die nach wie vor gültige Charta der PLO, die die Vernichtung Israels zum Ziel hat, und sehen einen anderen Weg zum Frieden. Diesen möchte ich hier meine Stimme geben.
Doch meine Antwort gilt nicht nur dem „vatikanischen Vorstoss“, sondern allgemein dem vorherrschenden Bemühen, eine Lösung für den menschlich unlösbaren Konflikt zu suchen, ohne die tieferen Hintergründe und die biblische road map zum Frieden einzubeziehen.
Doch zuerst: wer bin ich? Geboren 1932 in Zürich, mit 20 Jahren bei den Kapuzinern eingetreten. Früh erkannte ich beim Bibelstudium die bleibende Rolle des jüdischen Gottesvolkes. Früh kam ich in Kontakt mit messianischen Juden und den Evangelischen Marienschwestern von Darmstadt mit ihrem Herz für die Juden. Ich begleitete viele Pilgergruppen ins Heilige Land, erweiterte meine Kontakte mit messianischen Juden und christlichen Israelwerken. Was ich in dieser Schrift darlege, ist Frucht jahrzehntelangen Studiums und vieler Begegnungen. Ständig werden mir neue Informationen zugespielt. Ich schrieb viele Artikel zum Thema, bis der GGE-Verlag mich bat, meine Gedanken im Büchlein „Der Nahostkonflikt im Licht der biblischen Prophetie und unsere christliche Antwort“ zusammenzufassen (nach drei Auflagen vergriffen). Der „Vorstoss“ des Vatikan liess mir „das Fass überlaufen“, weshalb ich diese Antwort schrieb und dafür mehrere zustimmende Rückmeldungen erhielt. Prof. Thomas Willi, evangelischer Judaist und Alttestamentler, schrieb mir : „Du stellst in Deiner Schrift, die mir Deine bislang konziseste und deutlichste Stellungnahme zu sein scheint, sehr plastisch die Zweistaaten- der Einstaatenlösung gegenüber, betonst m.E. zu Recht, dass die erstere im Grunde eine Verzweiflungs- oder Verlegenheitsauskunft ist und als solche keine Option der Hoffnung - im Grunde setzt sie genau wie die letztere ein grundlegendes Umdenken voraus, das Du nicht müde wirst, anzumahnen.“
Die vierte Auflage brachte einen massgeblichen Fortschritt gegenüber der vorausgehenden dank der Mithilfe von Prof. Joseph Sievers (im Folgenden PJS) am Päpstlichen Bibelinstitut (Biblicum) in Rom, Konsultor für die Kommission des Heiligen Stuhls für die religiösen Beziehungen zum Judentum. Er ist Priester in der Fokolarbewegung, die sich im Geist Jesu für die Einheit nicht nur unter den Christen, sondern auch im Dialog mit nichtchristlichen Religionen einsetzt.[1] Er hat meinen Text sorgfältig durchgeackert und half mir mit seinen vielen Anmerkungen, den Text von Pauschalisierungen und unnötiger Polemik zu befreien, ohne ihm die Würze zu nehmen. Seine Sicht will er nur als Privatmeinung verstanden wissen, nicht als Äusserung des Lehramtes. In manchem stimmen wir nicht überein, doch die offene Auseinandersetzung darüber, „hilft uns beiden vielleicht, unsere Ansichten zu verfeinern und fundierter darzustellen“ (PJS). Vieles konnte ich von ihm übernehmen. Doch als Bibelwissenschaftler sieht er Differenzen mit meiner „Bibelhermeneutik“ (Bibelauslegung), d.h. mit der Frage: wie kann man die biblische Prophetie (mit der Verheissung der Rückkehr der Juden in ihr Land) konkret auf das heutige Nahostgeschehen und den Friedensprozess anwenden? Das bewog mich das Unterkapitel 1.1. einzufügen über „die Bibel als road map zum Frieden“.
Schon seine Kritik zum provozierenden Titel gibt mir Anlass, mein Anliegen näher darzulegen. Die biblische Antwort steht nicht auf gleicher Ebene wie die politischen Lösungsversuche. „Eine Ein- oder Zweistaatenlösung betrifft Fragen des internationalen Rechtes“ (PJS). Mit der Bibel kann man für heute weder eine Ein- noch eine Zweistaatenlösung begründen. In der Zeit der Bibel gab es nur zweimal eine „Einstaatenlösung“, nämlich unter David und Salomo und unter Herodes, wo im selben Reich unter jüdischer Herrschaft zusammen mit Juden noch andere Völker lebten. Meine „biblische Alternative“ meint also nicht eine „Einstaatenlösung“ als politisches Gegenprojekt zur Zweistaatenlösung, sondern die Schaffung der geistigen Voraussetzungen, die eine politische Lösung überhaupt möglich machen. Sowohl die Ein- wie die Zweistaatenlösung sind unter den heutigen Umständen eine Utopie. Zu beiden bräuchte es eine massive Gesinnungsänderung beiderseits. Politisch kann es, wie Johannes Gerloff ausführt (s.u. Kap. 13), vorerst nur um ein provisorisches „Krisenmanagement“ gehen. Doch zeigt uns die Bibel, wie wir realistisch auf eine Friedenslösung hinarbeiten können. Der gundlegende Schritt ist das Ja zu Gottes Plan mit Israel, d.h. mit seinem jüdischen Volk und seiner „Wiederherstellung im Land der Väter“, wie es die „Judenerklärung“ von Nostra aetate 4 grundgelegt hat. Gerade hier scheiden sich die Geister und liegt das grösste Friedenshindernis. Ein grosser Teil der Christenheit, bis hinauf in die Vatikanpolitik, hat die politische Tragweite dieser biblisch begründeten Erklärung nicht erkannt. Solange der Grossteil der Kirchenführer in Israel und den Nahostländern die Juden mit ihrem Staat als illegitime Besatzer, delegitimiert, und sich lieber mit ihren muslimischen Volksgenossen solidarisiert, ist der Frieden blockiert. Hier geht es um eine für den Frieden relevante Glaubensfrage, die von den Glaubenshütern konziliär anzugehen ist. Auf der andern Seite sammeln sich überall Christen und vernetzen sich im Geist des Friedensplanes Gottes, denen man sich anschliessen kann zur konstruktiven Zusammenarbeit am Aufbau der „völkerverbindenden Gottesstadt“ im biblischen „Einstaatenplan“. Ich begnüge mich also nicht mit dem weltentrückt scheinenden Leitbild von Jes 2,1-5, wo alle Völker auf Zion den Frieden finden mit den Ersterwählten unter dem Gott Jakobs, sondern zeige, wo man heute schon Hand anlegen kann.
Die fünfte Auflage brachte eine weitere Bereicherung durch den Beitrag von Hanspeter Büchi, der seit Jahren die Geschichte Israels mit der komplizierten Rechtslage intensiv verfolgt. Seine „realpolitische“ Sicht ist eine gute Ergänzung zu meiner biblisch-theologischen „Über-Sicht“. Seine Beiträge sind mit Ausnahmen markiert mit HPB.
Die nun vorliegende sechste Überarbeitung verdanke ich der aufmerksam-kritischen Lektüre des Buches von Ari Shavit „Mein gelobtes Land: Triumph und Tragödie Israels“ (Bertelsmann 2015), das mein Mentor Prof. Thomas Willi selber mit Spannung verschlungen hat und mir mit diesen Worten ans Herz legte: „Die Stärke dieses scharfsinnigen und einfühlsam-gerechten Buches liegt auch darin, dass es völlig leidenschaftsfrei auch der arabisch-palästinensischen Seite mit den unvergessenen Traumata der naqba (s.u. Kap. 6) von 1948 gerecht wird.“ Shavit ist politischer Kommentator der israelischen, zionismus- und regierungskritischen Zeitung Haaretz. Er gehört zu jenen jüdischen Intellektuellen, welche das Unrecht an den Palästinensern beim Namen nennen und mit ihrem Leidensweg mitfühlen, doch hilflos vor dem menschlich unlösbaren Dilemma stehen, da sie den biblischen Ausweg nicht kennen. Zum Beitrag von Ari Shavit siehe das Unterkapitel 6.1.
Ergänzend zur Auswertung des Buches von Ari Shavit bringe ich jene des Buches von Ulrich Kadelbach über die enge Beziehung zwischen dem Zionismus Herzl’s und dem christlichen Zionismus im Kapitel 7.
Wer offen ist für beide Seiten, findet bei Juden trotz allem mehr Einfühlung für die Not der Palästinenser als bei muslimischen Arabern, die von Kindheit an gemäss dem Koran mit Verachtung und Hass auf die Juden erzogen werden. Zahlreiche zionismuskritische jüdische Autoren empören sich über das Unrecht der „Besatzer“ an den Palästinensern. Allerdings gibt es auch muslimische Intellektuelle, die in den Medien bewundernd eine Lanze für Israel brechen und den muslimischen, selbstzerstörerischen Hass auf Israel blossstellen. [2]
1.1. Die Bibel als „road map zum Frieden“?
Bibelwissenschafter, so auch PJS [3], die sich auf die geschichtliche Seite der Bibel konzentrieren, sind begreiflicherweise skeptisch gegen die Anwendung von Bibelstellen auf das Gegenwartsgeschehen. Dies täten die „Fundamentalisten“. Mit der Bibel könne man schliesslich alles beweisen und einander als „unbiblisch“ abwerten und bekämpfen (Protestanten versus Katholiken und umgekehrt). Das zeigt drastisch die „palästinensische Befreiungstheologie“, welche im „Kairos-Palästina-Dokument“ (s.u. Kap. 8) anhand der Bibel „beweist“ und als „Wort des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe“ in alle Welt hinausposaunt, dass nun die Palästinenser und nicht mehr Israel (die Juden) Gottes Verheissungsvolk sind.
Der bekannteste Vertreter der palästinensischen Befreiungstheologie ist (nebst dem evangelischen Pfarrer von Bethlehem Mitri Raheb) der anglikanische Geistliche Naim Stifan Ateek. Er trat mit seinem Buch “Recht, nichts als Recht! Entwurf einer palästinensisch-christlichen Theologie“ [4] an die Weltöffentlichkeit, um für dieses Anliegen mit biblischer Scheinargumentation zu werben. Darin vertritt er einen „neuen Weg“ der Auslegung der biblischen Botschaft, nämlich die dem Volk Israel zugesprochenen Verheissungen auf die Palästinenser umzumünzen, im Sinn der alten „Enterbungstheologie“ (s.u. Kap.4). Dazu gründete er 1994 die Organisation „Sabeel“, worin er dem „christlichen Zionismus“ (s.u. Kap.7) scharf den „christlichen Palästinismus“ (Christian Palestinianism) entgegenstellt. Seine Osterbotschaft 2001 lautete: „Hier in Palästina trägt Jesus wieder sein Kreuz durch die Via Dolorosa. Palästina ist ein neues Golgotha geworden. Jesus ist der wehrlose Palästinenser,… umgeben von Tausenden von gekreuzigten Palästinensern“. [5] Gewiss gilt der Mahnruf Gottes “Recht, nichts als Recht!“ (Jes 56,1; 1,17; 61,2) auch heute den Israelis, aber nicht weniger den Israelfeinden mit ihrem weit grösseren Unrecht, wie wir sehen werden.
Diese Verwirrung hinsichtlich der Bibelauslegung drängt mich, die Grundsätze der authentischen Bibelauslegung (in katholisch-ökumenischer Version) darzulegen. Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Damit verbinden sich zwei Ebenen nach der Analogie der Menschwerdung Gottes im Menschen Jesus. Die menschliche Seite erfordert die Beachtung der geschichtlichen Umstände, in denen der biblische Autor damals das Wort gesagt hat bzw. in denen der Text entstanden ist. Dazu ist die Bibelwissenschaft mit ihren historischen und sprachwissenschaftlichen Methoden zuständig. Sie beantwortet die Frage: was wollten die biblischen Autoren bzw. die Endredaktoren ihren Adressaten damit sagen?
Dass die Bibel zugleich Gottes Wort ist, besagt, dass Gott die menschlichen Autoren und jene, welche die einzelnen Traditionen und Schriften zur „Heiligen Schrift“ zusammengestellt haben, durch „Inspiration“ (Führung durch den Heiligen Geist) so gelenkt hat, dass die Glaubenden aller Zeiten darin Gottes Weisung für ihre Zeit erkennen können. Dabei ist zu beachten, dass der göttliche Autor als Adressat das ganze Gottesvolk bis zum Vollendung am Ende der Zeit „vor Augen hat“ und dass darum die Bibel prophetisch ist und mehr aussagt, als die damaligen Autoren und Überlieferer vor Augen haben konnten. Insbesondere findet das Alte (Erste) Testament seine Erfüllung und Deutung in Jesus (Lk 24,26f.32.44-46; 2 Kor 1,20), obwohl auch gilt, das Erste Testament vorerst in seinem Selbstverständnis (d.h. im Verständnis der Juden und mit Juden zusammen) ernst zu nehmen und nicht vorschnell zu „christianisieren“. Die Bibel ist also nicht, wie angeblich der Koran, direkt vom Himmel diktiert worden, sondern als Buch des Gottesvolkes unter Führung des Heiligen Geistes gewachsen, von der Kirchenleitung aus Einzelschriften ausgewählt und den Gläubigen als „Kanon“ („Richtschnur“ des Glaubens) vorgelegt worden. „Der Schriftkanon ist die autoritative Liste der heiligen, d.h. unter göttlicher Inspiration entstandenen, den Glauben normierenden und in der Liturgie verlesenen Schriften gemäß der apostolischen Überlieferung der Kirche“ (Kathpedia). Jesus hat verheissen, durch seinen Geist den Gläubigen zur jeweiligen Zeit den Sinn der Schrift zu erschliessen (vgl. Joh 14,26; 16,13). Nach 2 Petr 1,11 ist „das Wort der Propheten“, bestätigt durch Jesus, „ein Licht, das an einem finstern Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Bedenke dabei dies: Keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden; denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Auftrag Gottes geredet“ (2 Petr. 1,20f). [6]
Angewendet auf unser Thema der „Wiederherstellung Israels“. Es gibt in der Bibel grundlegende Aussagen, die allen klar sein sollten, und sekundäre Aussagen, die von den grundlegenden Aussagen aus noch abzuklären sind. Als grundlegend setze ich voraus, was auch das Konzil aufgrund der klaren Aussage des Neuen Testamentes, vor allem von Röm 9-11, bestätigt hat: dass die Erwählung des jüdischen Volkes mit den endzeitlichen Verheissungen seiner „Wiederherstellung“ „unwiderruflich“ ist, entgegen der noch stark verbreiteten „Enterbungslehre“. Viele haben noch nicht erfasst, dass Gott heute bereits drangegangen ist, diese Verheissungen zu erfüllen. Da geht es um die Mahnung Jesu, die „Zeichen der Zeit“ zu verstehen und danach zu handeln. Dazu braucht es eine „neue Ausgiessung des Heiligen Geistes“ (was auch die Hoffnung der letzten Päpste war), der die Christenheit vereint in der Erkenntnis, „was der Geist zu den Gemeinden spricht“ (Offb 1,7 u.a.). Dazu gehört die Überwindung der Spaltung zwischen den beiden, anschliessend dargestellten Lagern. Dazu wächst ein ökumenischer Konsens von „Israelfreunden“, dem ich dienen möchte auf der Basis der gemeinsamen Schrift.
In dieser Richtung wächst ein neuer Zweig der Bibelwissenschaft: die „kanonische Bibelauslegung“. Pionier dieses Zugangs ist der reformierte englische Bibelwissenschafter Brevard S. Childs mit seinem fundamentalen Werk: „Die Theologie der einen Bibel“. [7]
Der deutsche Herausgeber, Manfred Oemig, der sich vom Kritiker zum Befürworter gewandelt hatte, schreibt über dieses Werk (in Band 2, S. 11): „Childs versucht, die Trennung der theologischen Disziplinen zu überwinden. Er überbrückt nicht nur die unsachgemässe Trennung von alttestamentlicher und neutestamentlicher Theologie, sondern führt darüber hinaus die Exegese mit der Dogmatik (samt der Kirchen- und Dogmengeschichte) in einem fruchtbaren, gegenwartsbezogenen Dialog zusammen. Als reformierter Theologe, der von der Wort-Gottes-Theologie K. Barths stark beeinflusst ist, sucht er das kritische Gespräch mit der neoliberalen Theologie… Er überwindet ein individualistisches Verstehen durch die Herausarbeitung der hermeneutischen Bedeutung von Kirche als Glaubensgemeinschaft…“ Durch diesen „kanonischen Ansatz“ setzt sich Childs „vom Fundamentalismus auf der rechten und vom Liberalismus auf der linken Seite“ ab (Bd. 2, S. 90). Damit ist die Zielrichtung der „kanonischen“ Auslegung klar angezeigt: es ist der goldene Mittelweg (zuweilen eine Gratwanderung) zwischen zwei Extremen.
Diese „kanonische Met-hode“ (wörtl. Zu-gang), die zwar im Detail noch viele Fragen offen lässt, ist auch für mich wegweisend – wie für Papst Benedikt em. in seiner Trilogie „Jesus von Nazaret“, wo er ausdrücklich die „kanonisch-christologische“ mit der „historisch-kritischen“ Methode verbindet.
Letztlich zielt diese Methode darauf hin, sich durch die biblischen Texte hindurch zu verbinden mit dem Geist, der durch diese Texte heute „zu den Gemeinden spricht.“ Konkret zu unserem Thema Israel bedeutet dies, sich eins zu machen mit der alles Begreifen übersteigenden Liebe Gottes zu seinem Erwählungsvolk, nach dem Beispiel Jesu und des Paulus, der bereit war, verflucht zu sein, um seine Brüder zu retten (Röm 9,3). Wer sich von dieser Liebe erfassen lässt, dem wird sich auch der Sinn für das rechte Verständnis der Schrift und deren Anwendung auf die „Zweistaatenlösung“ ausweiten, wobei man freilich die politische und die religiöse Ebene nicht vermischen darf (PJS).
Mit diesem „neuen Blick“ wird man auch die bildhaften Ausschmückungen der Propheten über die Wiederherstellung sinngemäss aktualisieren: „Wenn der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Garten, und der Garten wird zu einem Wald“ (Jes 32,15; vgl. 35,6ff u.a.). Freilich wussten die biblischen Autoren nicht, wie die Zionisten dies verwirklichen würden, indem sie durch neue Landwirtschaftsmethoden das Land aufblühen lassen, Wüsten fruchtbar machen und Wälder pflanzen. Oder die Propheten schildern, wie die Völker die zersprengten Kinder Israels bei ihrer Heimkehr unterstützen: „Auf Pferden und Wagen und in Sänften und auf Maultieren und Kamelstuten werden sie all eure Brüder aus allen Nationen dem HERRN als Gabe bringen, auf meinem heiligen Berg, nach Jerusalem, spricht der HERR“ (Jes 66,20; ähnlich Jes 60,4 („Deine Töchter trägt man auf den Armen herbei“) und 66,12. Freilich wussten die Bibelautoren nicht, wie heute diese Heimkehr von den Völkern unterstützt wird: durch die völkerrechtliche Absicherung der UNO und durch Organisationen, welche die Heimführung organisieren. Oder wenn nach Sacharja 12 am Ende der Zeit sich alle Völker gegen Jerusalem verbünden, dann liegt es wiederum in der Linie der biblischen Prophetie, dies zu beziehen auf den heute wachsenden Antizionismus, die politische Isolierung durch die UNO und die militärische Bedrohung von islamistischer Seite. Der Heilige Geist, der die biblischen Autoren inspirierte, sah dies voraus, ohne dass diese es wissen konnten. Dazu sind die historisch-kritischen Exegeten nicht zuständig, so wichtig sie als „Zulieferer“ auch sind; dazu braucht es eine „kanonisch-kontextuelle“ Auslegung im weiten Sinn.
Freilich würde man die Zitate aus Jesaja und Sacharja „fundamentalistisch“ einseitig „proisraelisch“ verstehen, wenn man sie nicht „kanonisch“ aus dem Gesamtkontext der Bibel zu Fragen des Landes, der Gerechtigkeit und zur Beziehung zu den Fremden versteht. Eine der wichtigsten neutestamentlichen Aussagen über das Land ist zweifelsohne „Selig, die keine Gewalt anwenden¸ denn sie werden das Land erben“ (Mt 5,5 EÜ). „Davon sind leider beide Seiten heute weit entfernt. Dazu kommen die vielen Aussagen des Alten Testamentes, dass das Land Gott gehört (weshalb Gott wegen Untreue sein Volk auch aus dem verheissenen Land vertreiben kann und dies tatsächlich mehrmals tat, TM) . Er wird seine Verheissungen nicht zurücknehmen, aber wie die Grenzen verlaufen, und ob es eine Ein- Zwei- oder Mehrstaatenlösung gibt, das steht nicht uns zu, zu entscheiden“ (so trefflich PJS).
Um die Brücke zu bauen von der Schrift aus die konkrete Gegenwart braucht es die vom Heiligen Geist geschenkte Aufmerksamkeit für die „Zeichen der Zeit“ (Lk 12,56), in der sich die Bibel als prophetisches Buch aktualisiert. Dafür aufgeschlossen sind hochrangige Bibelwissenschafter wie Klaus Wengst, Thomas Willi, Wolfgang und Ekkehard Stegemann u.a., die sich auch im Alltag (mit öffentlichen Appellen u.a.) „pro Israel“ einsetzen.
2. Die beiden Lager
Quer durch alle Kirchen geht eine Spaltung zwischen zwei hart aufeinanderprallenden Geistesrichtungen. PJS plädiert zu Recht dafür, dass man die Differenzen im Geist des Evangeliums angeht, ohne zu verallgemeinern und zu polemisieren, mit Einfühlung und Weisheit. Nach seiner „Stossrichtung“ befragt, antwortete er mir: „Ich habe keine Stossrichtung, denn die erste Regel der Medizin ist, nicht zu schaden. Um für den Frieden zu arbeiten, möchte ich nicht stossen, sondern zu heilen versuchen, erst im Fürbittgebet und dann in Aktion (Sonntag werde ich nach Jerusalem fliegen, um an Gesprächen mit christlichen und jüdischen Brüdern und Schwestern teilzunehmen)“. – Diese liebevolle und behutvolle Haltung, mit der PJS zwischen gegensätz-lichen Gruppen zu vermitteln versucht, bringt es mit sich, dass er sich an meiner Art stösst, die Anhänger der Enterbungslehre und den Islam als blind für Gottes Friedensplan zu bezeichnen. Darin liege die Gefahr der Überheblichkeit, der ich entgegen zu wirken suche mit der Mahnung, die Hauptschuld im eigenen Lager und bei sich selber zu suchen, konkret im Nahostkonflikt nicht bei den Juden und im Islam, sondern im eigenen christlichen Lager. Mea culpa! Aber ohne klares Bemühen um „Unterscheidung der Geister“ kommen wir nicht durch! Das kann manchmal auch weh tun.
Zu meiner Charakterisierung der beiden Lager sagte PJS: „Das scheint mir wie eine Karikatur sehr differenzierter Positionen zu sein.“ Tatsächlich kann man die beiden Lager nicht eindeutig voneinander abgrenzen. Darum bringe ich zum Vergleich verschiedene Varianten der Gegenüberstellung, wobei jede Typisierung mangelhaft bleibt und für den Einzelfall variiert werden muss.
Die erste Gegenüberstellung verdanke ich HPB, der mehr auf die rechtliche Seite eingeht (kursiv):
„Die eine (propalästinensische) Gruppe sind diejenigen, die ungeachtet der gültigen, vom Völkerbund 1922 geschaffenen Rechtsbasis für die Einwanderung der Juden in das Gebiet zwischen Jordan und Mittelmeer (Völkerbundmandat 1922) deren Anwesenheit vehement ablehnen. Dies mit fadenscheinigen Gründen (Verdrängung, Enteignung) oder basierend auf der islamischen Lehre, wonach früher muslimisch beherrschtes Gebiet nie von Ungläubigen dominiert werden darf. Dazu kommt natürlich die oft erschwerte Lage der 1948 geflüchteten rund 600'000 Palästinenser, die zu integrieren sich die riesigen arabischen Länder geweigert haben, nicht zuletzt deswegen, um das „ungelöste Flüchtlingsproblem“ als Waffe gegen Israel zu verwenden. (Die damals aus arabischen Ländern geflüchteten über 800'000 Juden wurden grösstenteils in Israel aufgenommen, ein Flüchtlingsdrama, das nie erwähnt wird.). Die nach dem Krieg von 1967 entstandene Rolle der israelischen Armee als Besetzerin im sog. Westjordanland (ehemals Judäa/ Samaria) bietet dem antiisraelischen Lager immer wieder Munition für die psychologische Kriegsführung gegen Israel. Nicht beachtet wird dabei, dass nach einem kriegerischen Konflikt gemäss Law of War für eingenommenes Gebiet automatisch der Status „besetzt“ gilt, bis die territorialen Fragen geregelt sind(1967 z.B. Judäa/Samaria – sog. Westjordanland.) Dass die plakativ kritisierten Checkpoints und die Schutzmauer (nicht Sperrmauer) zum Schutz vor palästinensischen Terroristen gebaut wurde, davon lesen wir kaum etwas. Ausgeblendet werden auch die Satzungen der PLO/Fatah und Hamas, die zur Vernichtung Israels aufrufen. Auch kein Thema ist die Hetze gegen Juden und Israel, von der vor allem die Jugend infiziert ist. Das pro-palästinensische Lager arbeitet mit Schlagworten, wie „gerechter Friede“ etc., spricht von angeblicher Unterdrückung, von Apartheid seitens Israel und beruft sich auf territoriale Ansprüche, die rechtlich keinen Bestand haben, - alles Argumente, die die westlichen Medien – auch viele Kirchen - willig und unkritisch übernehmen, was geeignet ist, Antisemitismus und Hass gegen Israel zu schüren. Übersehen wird auch die Tatsache, dass die sogenannten Palästinenser zu rund 75% aus Einwanderern oder deren Nachkommen bestehen. Den ab 1882 einwandernden Juden folgten zahlreiche Muslime, da sich Arbeitsmöglichkeiten ergaben. Das pro-palästinensische Lager blendet somit grundlegende Fakten und Probleme aus, wobei natürlich zu bedauern ist, dass viele Palästinenser unter dem von ihren Führern kompromisslos geschürten Konflikt zu leiden haben. Auch die konsequente Ausrichtung der Jugend auf den Kampf gegen Israel sät eine böse Saat, die nicht ohne weiteres ausgerissen werden kann. So bleiben an der Oberfläche negative Schlagworte, zu denen auch die Behauptung gehört „Sie haben uns das Land weggenommen. [8]
Die andern (proisraelisch Engagierten) berufen sich auf die rechtlich gültigen Grundlagen Israels, basierend auf dem Völkerbundmandat von 1922, in dessen Präambel ausdrücklich die Anerkennung der historischen Verknüpftheit (historical connection) des jüdischen Volkes mit Palästina und der Grundlagen für die Wiedererrichtung seiner Heimstätte in diesem Lande hervorgehoben werden.
Mit dem Mandat wurde England beauftragt, die Balfour-Deklaration von 1917 umzusetzen und im Gebiet zwischen Jordan und Mittelmeer die Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten. Es hatte Platz für alle, 70% des Gebiets waren in Staatsbesitz. An diesen Rechten hat sich deshalb nichts geändert, weil die Araber 1947 den UNO-Teilungsplan – ein Vorschlag - abgelehnt hatten.“
Dazu bemerkt PJS: „ Israel wehrt sich gegen Anwendung internationalen Rechtes und unterstützt Bautätigkeit auch dort, wo es um palästinensischen Privatbesitz geht. Überdies werden häufig und anscheinend planmässig arabische Dörfer von ihren Feldern und ihren Wasserquellen getrennt.“ – Hier gilt: Recht gegen Recht, Unrecht gegen unrecht. Wer nicht beide Seiten miteinander abwägt, gerät ins Unrecht. Dass das „internationale Recht“ zu hinterfragen ist, sollte genügend klar sein.
Entscheidend bei dieser zweiten Gruppe ist, dass ihre Vertreter neben der „weltlichen“ Rechtslage hinter dem ganzen Nahostgeschehen einen weisen Plan Gottes sehen: die für die messianische Zeit verheissene „Wiederherstellung Israels“ mit der „Heimkehr ins Land der Väter“, die zum Segen für die Palästinenser hätte werden können, wenn dies nicht durch das Versagen der Mitbeteiligten (Christen und Muslime) verhindert worden wäre. Sie sehen realistisch die gegenwärtige Not des umkämpften Judenstaates und setzen sich als Israelfreunde dafür ein, dass sich das Leitbild der Vision der Völkerwallfahrt von Jes 2,1-5 verwirkliche, nämlich dass Israel der Ort wird, wo die Völker (vertreten durch Muslime und Christen) hier unter dem Gott Jakobs (vertreten durch sein ersterwähltes Volk) frei als Gotteskinder leben können. Statt über die Not und das Unrecht zu klagen, arbeiten sie am Brückenbau zwischen den verfeindeten Völkern und bauen Oasen und Stützpunkte des Friedens, wo Juden und Nichtjuden sich unter dem König und Messias Israels zum gemeinsamen Einsatz finden. Während viele propalästinensische „Friedensaktivisten“ ständig einseitig „die bösen Juden“ anklagen, nehmen die christlichen Freunde Israels zwar auch das Unrecht auf der israelischen Seite ernst, aber sehen es im Zusammenhang mit der Schuld auch der „andern Seite“ und im Licht des Planes Gottes (vgl. Röm 11,32).
Die zweite Gegenüberstellung stammt vom Jesuiten und gebürtigen Juden David Neuhaus (mehr über ihn s.u. Kap. 7). Die Spaltung der Christenheit in der Israelfrage brachte er zum Ausdruck an der „International Theological Conference“ auf dem „Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF)“ in Bern, 10.-14. Sept. 2008, eingeladen vom Ökumenischen Weltkirchenrat und Schweizer Protestanten. Er eröffnete seinen Vortrag mit der Feststellung:
„Eine neue Spaltung wird deutlich unter den Christen, nicht wegen theologischer oder christologischer Differenzen, sondern vielmehr wegen der Ereignisse, die sich im biblischen Stammland abwickeln, das je nach Standpunkt Israel oder Palästina genannt wird, und den Christen als Heiliges Land oder verheissenes Land bekannt ist. Die eine Gruppe von Christen bemüht sich aufrichtig um die Versöhnung mit den Juden und vertreten (nicht immer absolut, doch entschieden) den jüdischen Anspruch auf das Land Israel. Eine andere Gruppe von Christen engagiert sich nicht weniger aufrichtig (nicht immer absolut, doch entschieden) für das christliche Zeugnis für die Werte von Gerechtigkeit und Frieden und damit für eine leidenschaftliche Solidarität mit dem palästinensischen Volk, das kämpferisch um die Befreiung ihres Heimatlandes bemüht ist.“
Dies macht den Eindruck, entweder stehe man für die biblische Berufung der Juden und ihre von Gott gewollte „Heimkehr“ ein und sei dadurch notwendig gegen die Palästinenser, oder man setze sich für „Gerechtigkeit“ für die Palästinenser und für „Rückgewinnung ihres Heimatlandes“ ein und sei damit notwendig gegen Israel und die „christlichen Zionisten“. Neuhaus macht kein Hehl daraus, dass er sich, obwohl Jude, zur zweiten Gruppe zählt. Dass die Bibel eine Alternative anbietet, welche beiden Gesichtspunkten gerecht wird, übersteigt offenbar seinen Horizont.
Eine dritte Gegenübestellung macht der in Jerusalem lebende Theologe und Arzt, Yochanan ben-Daniel, der in einem Artikel die zwei Gruppen „Katholiken für Palästina“ und „Katholiken für Israel“ so charakterisiert: [9]
„Die ‚Katholiken für Palästina’ wollen Gerechtigkeit für sich selber und ihr Volk in Form einer eigenen politischen Souveränität (ein Reich von dieser Welt) und sorgen sich nicht um die Juden, während die ‚Katholiken für Israel’ die Erfüllung von Gottes Willen und seiner Gerechtigkeit für die Juden und nicht für sich selber wollen“ . Oder ausführlicher: „’Katholiken für Palästina’ schreien nach Gottes Gerechtigkeit in der Form eines unabhängigen palästinensischen Staates, während ‚Katholiken für Israel’ zwar sehr aufmerksam sind für das Leiden der Palästinenser und es zu erleichtern suchen, doch Sinn und Verständnis haben für die endzeitliche (eschatologische) Bedeutung der jüdischen Heimkehr. Darum widerstehen sie jedem Versuch, dies zu verhindern, denn sie erkennen dies als entscheidende Phase in der Heilsgeschichte, wo Gott endgültig seine Gerechtigkeit über die ganze Menschheit aufrichten wird.“
Wie man diese entgegengesetzten Denkrichtungen auch charakterisieren mag, es geht um die Anerkennung und Nichtanerkennung der bleibenden jüdischen Sonderberufung mit der Verheissung der Wiederherstellung im Land der Väter, für welche die Christenheit schon früh blind wurde und erst allmählich gegen Widerstand dran ist, von der Augenbinde befreit zu werden. Das Hindernis nennt man „Enterbungstheologie“ oder „Ersatztheologie“, mit der wir uns im Kapitel 4 weiter befassen werden.
3. Bedenkenswertes aus der Vorgeschichte
Um klar den Weg in die Zukunft zu finden, muss man zurück zu den Wurzeln in der Vergangenheit, um zu sehen, wie der Konflikt entstanden ist und auf die verpassten Gelegenheiten hinweisen, die sich im Laufe der Jahre geboten haben, und die den Konflikt hätten entschärfen können.
Schon mehrmals hätten die Palästinenser, Gelegenheit gehabt, einen eigenen Staat zu haben. Schon 1937 beim britischen Teilungsplan der Peel-Kommission, den die Araber ablehnten, die Juden zögernd annahmen, dann wieder beim UNO-Teilungsplan 1947, den die Araber verwarfen, die Juden annahmen. Dabei wäre Jerusalem mit Zugang zum Meer internationalisiert worden. Und als von 1948-1967 Jordanien (widerrechtlich) Judäa und Samaria (von Jordanien neu Westjordanland genannt) und Ägypten den Gazastreifen - alles Teile des ehemaligen Mandatsgebiets - okkupierten, hätten die arabischen Politiker reichlich Gelegenheit gehabt, ihren palästinensischen Volksgenossen zu einem eigenen Staat zu verhelfen. Manchen israelischen Politikern war bewusst, dass die Palästinenser eine genügende Autonomie brauchen, um in einem „Judenstaat“ ihre eigene Kultur leben zu können. Dem kam besonders Präsident Ehud Barak mit einem ausserordentlich weitreichenden Angebot entgegen, das aber abgelehnt wurde nach dem Grundsatz „alles oder nichts“.
Doch warum lehnten die Palästinenser konstant diese Chancen ab? Unter „Palästinenser“ verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht das einfache, liebenswürdige palästinensische Fussvolk, das unter den Osmanen und z.T. unter den Briten friedlich mit den Juden zusammenlebte, sondern ihre politischen Führer, durch die der islamische Virus sich ausbreiten konnte. Aus ihrem islamischen Hintergrund leuchtet es ein, dass sie keinen Judenstaat, auch wenn er noch so tolerant und demokratisch ist, in ihrem, seit Jahrhunderten von islamischen Herrschaften dominierten und damit für Allah eroberten Gegend dulden konnten. Sie müssen das Gebiet mit Dschihad für Allah zurückerobern. Wie hätte das muslimische Volk vom göttlichen Heimholungsplan mit den Juden zu ihrem Segen wissen können? Was ein ideologischer Virus unter braven Bürgern anrichten kann, erlebten wir schon unter Hitler.
Die PLO wurde gegründet als Speerspitze gegen Israel. Ihre Charta von 1968 bezeichnet die Gründung des Staates Israel als illegal. Darum ist Israel zu beseitigen, auch mit bewaffneter Volksrevolution. Allerdings versprachen beim Oslo-Friedensprozess 1996 die PLO-Vertreter, die israelfeindlichen Passagen zu streichen. Einen entsprechenden Beschluss fällte auch der palästinensische Nationalkongress. Nur – es existiert keine entsprechend geänderte Version der Charta, sie wurde nie geändert. Zudem erinnert uns die permamente antiisraelische Hetze der PA und Hamas laufend an die Gültigkeit jener Charta. Nach Oslo verglich Arafat in einer Moschee in Südafrika das Abkommen mit dem 10- jährigen Waffenstillstand Mohammeds mit dem Stamm der Quarish, den Mohammed aber nach 2 Jahren brach. Im Palästinenserwappen bleiben die Umrisse des ganzen Landes (Israel sucht man darauf umsonst) als erstrebtes Hoheitsgebiet, und die PA-Führer bezeichnen weiterhin ganz Israel als „besetztes Palästina.“ Auf alle Fälle fehlt bei den Palästinenserführern (besonders bei der Hamas) die Bereitschaft, Erfahrung und Fähigkeit, einen Staat zu führen, der friedlich zu seinem Vorteil mit dem Judenstaat kollaborieren könnte. Netanjahu hat der Zweistaatenlösung schliesslich zugestimmt unter der Bedingung: „Die Palästinenser müssten die Existenz Israels anerkennen und aufhören, Israel zu ‚delegitimieren’“ und „Es müsse Sicherheitsstrukturen in den palästinensischen Gebieten geben, die verhinderten, dass eines Tages in Ramallah Raketen zusammengebaut und auf Israel abgefeuert würden.“ Tatsächlich sind vom Westjordanland in den letzten Jahren keine Angriffe mehr verübt worden und die Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte scheint momentan relativ gut zu sein (so PJS). Doch die Frage ist: wird es so bleiben, wenn im Palästinenserstaat die Hamas obenauf kommt, wie schon bei früheren Wahlen. Wie gesagt dürfen wir nicht dem palästinensischen Fussvolk die Hauptverantwortung für die Katastrophe zuschieben, denn sie selber wurden von ihren Führern „verraten“, wie wir vom Historiker Ephraim Karsh vernehmen werden (s.u. Kap. 12).
Früher gab es intellektuelle Juden und Araber, [10] welche die „Einstaatenlösung“ als einzig realistisch ansahen: Juden und Araber unter einer einzigen demokratischen Souveränität. Doch diese Hoffnung ist nun mehrheitlich aufgegeben. Auch wegen dem wachsenden jüdischen Siedlungsbau im Westjordanland, der ein zusammenhängendes palästinensisches Staatsgebiet immer unmöglicher macht [11]. Der jüdische Politologe und Zionismuskritiker Uri Avneri sagt, dass die Einstaatenlösung nur möglich wäre, „wenn beide Völker ihre Grundhaltung vollkommen ändern und ein Geist gegenseitiger Sympathie und Respekts den gegenwärtigen nationalistischen Hass und Verachtung ersetzt.“ [12] Da dies eine pure Utopie sei, sieht er die Zweistaatenlösung als die einzig realistische Lösung. Allerdings bräuchte es einen massiven internationalen Druck, um die beiden „zum Frieden zu zwingen“, was aber wiederum eine Utopie ist, da Frieden sich nicht mit internationalen Sanktionen aufzwingen lässt, schon gar nicht, wenn der Islam hineinspielt, für den es keinen verbindlichen Frieden mit Ungläubigen gibt.
Denken wir an München 1938, als Chamberlain meinte, mit Hitler einen Pakt „Land (Sudetenland) gegen Frieden“ abschliessen zu können, weil dieser u.a. am 26.9.1938 sagte: „Ich bin Herrn Chamberlain dankbar für alle seine Bemühungen. Ich habe ihm versichert, dass das deutsche Volk nichts anderes will als Frieden…“ Schön reden über Frieden bedeutet noch nicht Frieden (Jer 6,14!).
Das zeigt: Der Nahostkonflikt ist und bleibt ein geistlicher Kampf, den nur Gott nach seinem Plan beenden kann und es auch wird. Wer nach der Zweistaatenlösung drängt, zeigt, dass er sich keine Gedanken über die Wurzeln der Krise macht.
Die von Avneri genannte Gesinnungsänderung gilt auch für das Gelingen der Zweistaatenlösung. Wer wäre besser berufen, diesen Gesinnungswandel herbeizuführen, als die Christen und Kirchen im Heiligen Land? Sie könnten aus ihrem Glauben die providentielle Brücke sein zwischen ihren israelfeindlichen muslimischen Volksgenossen und der jüdischen „Besatzungsmacht“. Doch dazu fehlt ihnen, soweit sie noch von der Enterbungslehre beherrscht sind und die Heimkehr der Juden nicht als Erfüllung des Planes Gottes sehen, die ihnen in der Bibel vorgegebene prophetische Sicht, wie es das folgende Kapitel weiter begründet.
4. Die Verhaftung an die „Enterbungstheologie“ verhindert den Brückenbau zu den Juden
Dieser Mangel an prophetischer Sicht hängt zusammen mit der seit den Kirchenvätern eingefleischten antijüdischen Haltung, genauer der „Enterbungstheologie“ (oder „Ersatztheologie“), welche besagt, dass die Juden durch die Verwerfung des Messias ihre Sonderberufung als das zu einem besonderen Dienst erwählte Gottesvolk verloren haben. Die Kirche sei nun an Stelle des „enterbten“ Israel getreten. Die an Israel ergangenen massiven Verheissungen seiner „Wiederherstellung“ in der messianischen Zeit mit der „Heimkehr ins Land der Väter“ seien nun hinfällig geworden. Gegen diese Irrlehre und Fehlhaltung musste sich schon Paulus im Römerbrief, Kap. 9-11 leidenschaftlich wehren.
Diese Irrlehre hat in der Kirchengeschichte den Juden viel Leid gebracht bis zum Höhepunkt im Holocaust. Das Vatikanische Konzil (1962-65) hat mit der sich vor allem auf Paulus stützenden „Judenerklärung“ eine „kopernikanische“ Wende gebracht. Es bezeugt:
„Den Juden gehören (immer noch) die Verheissungen… Sie sind immer noch von Gott geliebt um der Väter willen, sind doch seine Gnadengaben und seine Berufung unwiderruflich“ (Nostra aetate 4).
Nicht alle Bischöfe haben diese Erklärung zur Kenntnis genommen bzw. akzeptiert. Während dem Konzil erfuhr diese Erklärung einen massiven arabischen Widerstand. Der wortführende melkitische Patriarch und Konzilsvater Maximos IV. hatte gar nach dem Konzil in seiner Kirche in Syrien erklärt: „Wir halten uns nicht an diese Erklärung!“ [13] Was die arabischen Bischöfe und Theologen zum Widerspruch reizt, ist die Aussage, dass die an die Juden ergangenen Verheissungen „unwiderruflich“ sind (z.B. 1 Chr 16,15-18). Diese Verheissungen zielen hin auf ihre „Wiederherstellung im Land der Väter“. Allerdings ist das Konzil nicht auf diese Konsequenz eingegangen, weil die arabischen Väter dies nicht ertragen hätten, doch als die französischen Bischöfe dies 1973 in einem Schreiben „ zur Haltung der Christen gegenüber dem Judentum“ umsichtig zur Sprache brachten, brach wieder ein Entrüstungssturm los bei ägyptischen Bischöfen und 40 libanesischen Jesuiten, welche den Text “ein Manifest von politischem Zionismus”, der auch vom religiösen Standpunkt aus “höchst anstössig” und schlichtweg “Irrlehre” sei, anprangerten. [14]
Was im Folgenden über die Kirchenführer in muslimischen Nahostländern auf Grund ihrer Belastung durch die „Enterbungstheologie“ gesagt wird, ist aber nur die eine Seite. Auf der andern, hellen Seite dürfen wir ihre reiche Tradition nicht vergessen, mit der sie noch mehr als die Westkirche mit der jüdischen Wurzel verbunden sind, nämlich mit ihrer Liturgie und der damit verbundenen Spiritualität. Darum fühlen sich Juden oft stärker daheim in der ostkirchlichen als in der westlichen Liturgie. Darum schliessen sich Juden gern der melkitischen Kirche an, wie folgendes Beispiel zeigt.
Ich kannte einen betagten melkitischen (griechisch-katholischen) Priester, Abraham Shmueloff, der als orthodoxer Jude in Jerusalem aufgewachsen war. Angetrieben von der Suche „Wer ist der Messias?“ fand er die Antwort, gegen den Widerstand der Rabbiner, im Evangelium und wurde Priester bei den Melkiten. Da begegnete ihm einmal, wie er mir erzählte, der melkitische Erzbischof Hilarion Capucci, der 1974 wegen versuchtem Waffenschmuggel für die Palästinenser von den Israelis verhaftet, aber auf vatikanische Intervention wieder freigelassen wurde. Hilarion begrüsste ihn herzlich. Doch als er vernahm, dass dieser Priester Jude ist, wollte er mit Abscheu nichts mehr von ihm wissen. So tief sass das antijüdische Trauma in diesem Bischof.
Doch auf der andern Seite löst sich auch in den Ostkirchen der Schleier, und es wachsen herzliche Beziehungen zu den Juden als ersterwähltem Gottesvolk. Das lässt voraussehen, welcher Reichtum für den Nahen Osten aufstrahlen wird, wenn sich die orientalischen, zusammen mit den westlichen Kirchen, zur jüdischen Wurzel zurückgefunden haben.
Der Staat Israel ist ein starkes Zeichen für die Treue Gottes zu seinem Volk. Darüber schreibt 1985 die vatikanische Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum im Dokument „Hinweise für eine richtige Darstellung von Juden und Judentum in der Predigt und in der Katechese der katholischen Kirche“: „Der Fortbestand Israels, (wo doch so viele Völker des Altertums spurlos verschwunden sind), ist eine historische Tatsache und ein Zeichen im Plan Gottes, das Deutung erheischt. Auf jeden Fall muss man sich von der traditionellen Auffassung freimachen, wonach Israel ein bestraftes Volk ist, aufgespart als lebendes Argument für die christliche Apologetik.“ [15]
Je mehr sich die zuständigen Kirchenführer vom biblischen Plan Gottes mit den Juden leiten lassen, desto mehr können sie zum Frieden beitragen.
5. Das klare Bekenntnis von Heinrich Spaemann
Es gibt gute Israeltheologen, welche zwar die Juden lieben und ihre bleibende Sonderberufung anerkennen, aber blind sind für das konkrete Handeln Gottes an Israel und anfällig für die israelfeindliche Sichtweise der Medien und propalästinensischen „Friedensaktivisten“. Ihnen fehlt der „neue Blick“, der zum Verständnis für das „Geheimnis Israel“ nötig ist, „damit wir uns nicht auf unsere eigene (aufgeklärte) Einsicht verlassen“ (Röm 11,25). [16] Von anderem Format ist der Geistesmann, Konvertit und Priester Heinrich Spaemann (1903-2001), der in einer flammenden Schrift ausrief:
„Das wichtigste Datum des 20. Jahrhunderts ist für den, der mit der Bibel denkt, die Wiedervolkwerdung Israels nach einem fast zweitausend Jahre währenden Passionsweg und nach Auschwitz als einem zweiten Golgotha – Johannes Paul II. nannte es mehrfach so. Diese ‚Auferstehung’ Israels ist Einlösung der Ezechielprophetie: aus einem unabsehbaren Totenfeld wird eine lebendige Heerschar (Ez 37,1-14). Dem Römerbrief nach ist sie das letzte Heilszeichen in der Menschheitsgeschichte vor dem Jüngsten Tag…“ [17]
Hier ist herauszuheben:
- Spaemann weigert sich nicht wie manche Exegeten, die biblische Prophetie auf das aktuelle Zeitgeschehen anzuwenden. Der Alttestamentler Erich Zenger zeigt, dass die biblische Prophetie dazu angelegt ist, immer wieder neu im Licht des in der Kirche wirkenden Geistes und der „Zeichen der Zeit“ ausgelegt zu werden.
- Der Autor scheut sich nicht, den Weg Jesu mit dem Weg des Judenvolkes parallel zu sehen, wie Papst Johannes-Paul II. es tat. (Gewisse Theologen sehen dies als ungeziemende christliche Vereinnahmung.) Diese Sicht hatte auch der jüdische Maler Marc Chagall in seiner Weissen Kreuzigung (s.u.), wo Jesus (als der sühnende Leidensknecht von Jes 53) am Kreuz mit dem jüdischen Gebetsschal als Lendenschurz das Leid der Juden mitträgt und mit seinem gottergebenen Sterben die Lichtbahn zum Himmel öffnet.
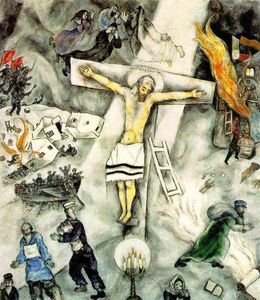 Die Konsequenz für uns Christen ist: wer den Juden auf ihrem schweren Kreuzweg mitfühlend beisteht, hilft Jesus das Kreuz tragen. „Was ihr den Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Der Matthäus-Kommentator Ulrich Lutz scheut sich nicht, „die geringsten meiner Brüder“ auf die Brüder Jesu „dem Fleische nach“ anzuwenden. Die Frage an die arabischen Kirchenführer: Helfen sie Jesus in ihren jüdischen Brüdern das Kreuz zu tragen?
Die Konsequenz für uns Christen ist: wer den Juden auf ihrem schweren Kreuzweg mitfühlend beisteht, hilft Jesus das Kreuz tragen. „Was ihr den Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Der Matthäus-Kommentator Ulrich Lutz scheut sich nicht, „die geringsten meiner Brüder“ auf die Brüder Jesu „dem Fleische nach“ anzuwenden. Die Frage an die arabischen Kirchenführer: Helfen sie Jesus in ihren jüdischen Brüdern das Kreuz zu tragen?
Freilich haben wir Jesus genauso zu sehen in den unter Schikanen und Unrecht leidenden palästinensischen Brüdern und Schwestern, den schwangeren Frauen, die an den Checkpoints abgewiesen werden und damit die rettende Spitalhilfe nicht erreichen können usw. Christliche Barmherzigkeit kennt keine Schranken.
6. Zionismus zum Segen für die Araber?
Wenn die Juden am 14. Mai freudig den Gründungstag ihres „Judenstaates“ feiern, begehen die Palästinenser den Tag der „naqba“ (Katastrophe), denn sie sehen den militärischen Sieg Israels 1948/49 mit der Eroberung weiter Landesteile mit der Vertreibung der arabischen Bevölkerung aus über 400 Dörfern Galiläas begreiflicherweise als ihre Katastrophe. Von israelischer Seite erwarten die Geschädigten noch Gesten der Wiedergutmachung. Doch wenn von der ausstehenden Wiedergutmachung von Seiten Israels gesprochen wird, müsste man auch die Werte berücksichtigt werden, die jene 830'’00 jüdischen Flüchtlinge aus arabischen Ländern zurücklassen mussten (HPB).
Doch genannte Katastrophe stellt sich in anderem Licht dar, wenn wir den Hintergrund beachten:
„Schon in den 30er Jahren hatte die Gewalt gegen die Juden zugenommen und nach der Ablehnung des UN-Teilungsplans durch die Araber herrschte praktisch Krieg. Am Tag nach der isaelischen Staatsgründung griffen 5 arabische Armeen Israel an, um es auszulöschen. Doch Israel wehrte sich trotz anfänglich nur notdürftiger Ausrüstung mit Erfolg. Der arabische Angriffskrieg war die Ursache der nun folgenden palästinensische Flüchtlingsbewegungen, wobei viele der rund 600'000 Araber ihre Dörfer verliessen , weil von arabischen Stellen dazu aufgefordert. 68% der Flüchtenden gingen, ohne die Israelis gesehen zu haben. Doch das Schlagwort „Nakba“ lässt sich – besonders mit Bildern - immer gut vermarkten, weil niemand kritische Fragen stellt“ (HPB).
Erhellend dazu ist das Zeugnis des Vaters von Emile Shoufani, des griechisch-katholischen Pfarrers von Nazaret, einem Pionier für den Brückenbau zwischen Arabern und Juden, vor allem mit seiner Schule. Sein Vater war Dorfältester und erlebte, wie sein Dorf von den Israelis erobert wurde. Er sagt, dass 60% der Verantwortung für das Zustandekommen des zionistischen Eroberungskrieges bei den arabischen Autoritäten liegen, weil sie durch Ablehnung des Kooperationsangebotes die Juden in den Krieg getrieben hätten. Unschuldig seien nur die wehrlosen Betroffenen. [18]
Dass der Zionismus zum Segen für die Araber hätte werden können, zeigt das Abkommen über arabisch-jüdische Zusammenarbeit von Chaim Weizmann, dem Präsidenten der zionistischen Weltorganisation, mit König Faisal bin Hussein (zeitweise König von Syrien und Irak, aus der haschemitischen Dynastie, die sich auf Mohammed zurückführt) anlässlich der Friedenskonferenz in Paris am 3. Januar 1919. Faisal erklärt:
„Wir Araber, vor allem die Gebildeten unter uns, schauen mit tiefster Sympathie auf die zionistische Bewegung. Unsere Delegation in Paris ist voll vertraut mit den Vorschlägen der zionistischen Organisation, die wir als massvoll und korrekt betrachten. Wir wollen unser Möglichstes tun, soweit es an uns liegt, den Juden dabei zu helfen. Wir wünschen ihnen ein herzliches Willkommen daheim… Ich und mein Volk mit mir schauen vorwärts in eine Zukunft, in der wir uns gegenseitig helfen werden, so dass die Länder, an denen wir beide interessiert sind, wieder ihren Platz in der Gemeinschaft der zivilisierten Völker der Welt einnehmen können. – Das Land ist reich an unbebautem Boden, der unter jüdischen Einwanderern erblühen wird.“
Die Triebkraft, die durch grosse Hindernisse zur Gründung des Staates Israel führte, war der Zionismus von Theodor Herzl, der seit dem ersten Zionistenkongress in Basel 1897 allmählich ein grosses Feuer von Begeisterung entfachte, obwohl er vorher mehrheitlich von der Judenheit als Utopie belächelt und abgelehnt wurde. Israelkritiker versuchen, den Zionismus als rein politisches Bemühen zur Schaffung eines säkular-nationalistischen Judenstaates darzustellen, um das heilsgeschichtliche Verständnis zu entkräftigen. Doch hat der Herzl-Forscher Georges Weisz gezeigt, dass der Zionismus, obwohl er vom rabbinischen Judentum abgelehnt wurde und sich umgekehrt von diesem distanzierte, von Anfang an aus einer biblisch-prophetischen Inspiration seine Kraft geschöpft hat. [19] Doch zeigte sich bald, dass der jüdische Zionismus aus sich allein sein biblisches Ideal nicht ohne Mithilfe eines christlichen, völkerverbindenen Zionismus, also von „christlichen Zionisten“ erreichen kann.
6.1. Zionismus als Katastrophe für die Palästinenser? Zum Beitrag von Ari Shavit
Viele Zeitgenossen sind allergisch auf die einseitige Liebe gewisser christlicher Israelfreunde für den Judenstaat und werden dadurch noch mehr ins propalästinsische Lager gedrängt. Um zu einem nachhaltigen Frieden zu gelangten und einseitige Schuldzuweisungen zu vermeiden, müssen wir beide Seiten genauso ernst nehmen in ihrem Versagen, ihren Hoffnungen und guten Seiten, was offenbar schwer fällt.
Der Vorwurf der Einseitigkeit gilt gewiss nicht dem bereits im ersten Kapitel vorgestellten monumentalen Werk von Ari Shavit (590 Seiten!): „Mein gelobtes Land: Triumph und Tragödie Israels“ (Bertelsmann 2015). Mit Hilfe vieler Interviews und Quellenstudien hat der Autor sich ein realistisches Bild der verschiedenen Lager und ihrer Vorgeschichte seit dem Beginn des Zionismus am Ende des 19. Jahrhunderts gemacht. Er beginnt mit seinem Ururgrossvater aus England, der als einer der ersten Zionisten im Auftrag Theodor Herzls eine Erkundungsfahrt ins damals osmanisch beherrschte Palästina machte, um abzuklären, wie eine jüdische Besiedelung dort geschehen könnte (an einen Staat hat man damals noch nicht gedacht). Erzählerisch nimmt er uns hinein in die Geschichte, die zur heutigen ausweglosen Situation geführt hat. Die ersten Zionisten, z.T. entflohen dem Schrecken der russischen Pogrome, zeigten mit ihren Kibuzzim eine stahlhart disziplinierte und begeisterte Einsatzbereitschaft zum Aufbau einer neuen Heimat durch Urbarmachung von Wüsten und Sümpfen, wobei man wenig Rücksicht nahm auf die einheimische Bevölkerung, die man gelegentlich sogar gewaltsam vertrieb, mit Ausnahme einiger Philanthropen, die sich hingebungsvoll der Einheimischen annahmen. Die Terrorangriffe von arabischer Seite auf die Juden, beginnend 1929 mit dem vom Jerusalemer Mufti und Hitlerfreund Amin al-Husseini angeführten Pogrom in Hebron, verstärkten bei den Siedlern das arabische Feindbild. „Die brutalen Ereignisse, zu denen es […] 1936 kam stürzten die Zionisten aus entrückter Seligkeit in eine ernüchternde Konfliktsituation, die für die Zukunft Schlimmes ahnen liess“ (Shavit S. 110). Allerdings hatten auch die Juden terroristisch agierende Gruppen.
Unter diesem Druck des Bedrohtseins sagte Ben Gurion 1938 in einer Ansprache: „Meine Lösung des Problems der Präsenz von Arabern im jüdischen Staat besteht in ihrer Umsiedlung in arabische Länder“ (S, 112). 1947 soll er gesagt haben: „Unser Ziel ist nicht ein jüdischer Staat in Palästina, sondern ganz Palästina als jüdischer Staat.“ [20] Ein anderer führender Zionist schrieb 1940 in sein Tagebuch: „Es muss klar werden, dass in diesem Land kein Platz für beide Völker ist“ (ebd.). Bis heute hat sich unter dem Druck der Ereignisse bei vielen Juden der Eindruck der Unvereinbarkeit beider Völker eingeprägt, was total dem biblischen Leitbild widerspricht, dass Israel ein Segen für die Palästinenser sei.
Shavit hütet sich, die Schuld für diese Not nur auf die eine Seite abzuwälzen. Er protestiert gegen das Verdrängen der zionistischen Schuld, Einheimische vertrieben und umgebracht zu haben. Er leidet, wenn er jüdische Städte und Siedlungen besucht, die auf dem Boden vertriebener oder ermordeter Araber gewachsen sind. Doch sieht er keinen Ausweg aus dieser Not ausser dem Postulat einer Trennung nach dem Grundsatz „Besser ein guter Nachbar in der Ferne als ein Feind in der Nähe“, also in Richtung Zweistaatenlösung.
Dabei ist zu beachten: „Im April 1897 [Jahr des ersten Zionistenkongresses] existiert überhaupt kein palästinensischen ‚Volk’. Palästinenser kennen noch kein Gefühl der Selbstbestimmtheit und noch keine nennenswerte Nationalbewegung. Der arabische Nationalismus ist gerade dabei zu erwachen“ (S. 32). Erst Yassir Arafat gründete 1957 die erste Zelle der Bewegung zur Befreiung Palästinas, mit dem Ziel, ein palästinensisches Nationalbewusstsein als Speerspitze gegen den Judenstaat heranzuzüchten.
Shavit gehörte in jungen Jahren zur Peace-Now-Bewegung (entsprechend unseren westlichen propalästinensischen „Friedensaktivisten“) und verfasste ein Flugblatt, in dem er das Siedlungsprojekt als Irrsinn bezeichnete. Doch dann überwand er diese Einseitigkeit in der Erkenntnis: „Israel ist der einzige westliche Staat, der ein anderes Volk besetzt hält. Israel ist aber auch der einzige westliche Staat, der in seiner Existenz bedroht ist. Besetzung und Bedrohung machen zusammen die Seinsbedingungen Israels einzigartig. […] Beobachter und Kommentatoren negieren meist diese Dualität. Diejenigen, die politisch links sind, befassen sich mit der Besetzung, ignorieren aber die Bedrohung, während die vom rechten Lager die Bedrohung hervorheben, die Besetzung aber übergehen. Die Wahrheit ist, dass man, wenn man nicht diese beiden Elemente in sein Weltbild aufnimmt, weder Israel noch den israelisch-palästinensischen Konflikt richtig verstehen kann“ (S. 13).
Shavit sieht den kleine Judenstaat in mehrerer Hinsicht bedroht: „entstanden mitten im Herzen der arabischen Welt. Die arabische Nationalbewegung hatte versucht, die Gründung Israels zu verhindern – und war gescheitert… So gesehen ist die blosse Existenz Israels als nichtarabischer Nationalstaat im Nahen Osten so etwas wie ein lebendiges Zeugnis für das Scheitern des arabischen Nationalismus“ (S. 544). Eine nicht mindere Bedrohung kommt durch den eigenen moralischen Verfall. „Lange Zeit verfügte Israel über eine moralisch einigermassen integre Gesellschaft. Die Mehrheit achtete die Menschenrechte und verschrieb sich der liberalen Demokratie… Die Furcht vor wachsenden arabischen Minderheiten bringt Fremdenfeindlichkeit und Rassismus hervor. Die fortgesetzte Besetzung, der anhaltende Konflikt und der sich auflösende Kodex eines humanitären Zionismus geben dunkeln Mächten Gelegenheit, die Nation zu unterwandern“ (S. 551f).
Die tiefste Bedrohung sieht Shavit in der Auflösung der jüdischen Identität, welche die ersten, das Land unter Opfern besiedelnden Zionisten in der Einheit zusammenhielt. Sie spürten, dass sie einen höheren Auftrag haben, gegen alle Hindernisse eine Heimstätte für ihr Volk aufzubauen. Doch unter dem erreichten Wohlstand „zerfällt unsere neue Identität in eine Vielzahl von Identitäten… Zurzeiten erkennen wir uns selbst nicht mehr. Wir sind nicht sicher, wer wir wirklich sind“ (S. 553). Nur das Ja zur besonderen Berufung als Gottes Eigentumsvolk im Sinaibund gibt den Juden letztlich ihre Identität. Besonders bedroht ist das säkulare Judentum in der westlichen, säkularen Welt mit der Gefahr, sich dem „Weltgeist“ anzupassen, im Unterschied zum orthodoxen Judentum, das in der Verbindung mit der Synagoge (früher unterstützt durch die erzwungene Absonderung) an der Treue zur Tradition festhält. Shavit hebt hervor, dass die Staatsgründung, verbunden mit dem Holocaust, die säkularen Juden noch im Bewusstsein erhält, ein besonderes Volk zu sein.
Als scharfsinniger Analytiker der Situation schliesst Shavit: „Im Augenblick gibt es keine Hoffnung auf Frieden: Kein gemässigter arabischer Führer verfügt über die nötige Legitimation, ein neues, den Konflikt beendendes Abkommen mit dem zionistischen Gemeinwesen zu unterzeichnen“ (S. 557), abgesehen davon, dass damit noch lange nicht der wahre, die Völker versöhnende Frieden erreicht wäre.
Shavit anerkennt die Verdienste der zionistischen Pioniere: „Mehr als ein Jahrhundert hindurch hat der Zionismus ein aussergewöhnlich hohes Mass an Entschlossenheit, Fantasie und Innovationskraft bewiesen. Seine Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Entschlusskraft waren ungeheuer“ (S.535). Doch nun zeigt sich, dass das zionistische Projekt an seine Grenze gekommen ist und statt zum Frieden zur Katastrophe führt: „Eine Bewegung, die in ihren frühen Tagen so gut wie alles richtig gemacht hat, machte in den vergangenen Jahrzehnten so gut wie alles falsch“ (S. 536).
Und dennoch schwingt bei Shavit im Blick auf die uralte jüdische Geschichte, die selbst den Holocaust und verschiedene arabische Vernichtungsangriffe überlebt hat, eine unterschwellige Hoffnung mit: „Und doch haben wir täglich Teil an einer phänomenalen historischen Vision. Wir partizipieren an einem Geschehen, das weit grösser ist als wir selbst… Wir sind noch da, an diesem biblischen Drehort“… , obwohl der Drehbuchautor scheinbar dem Bewusstsein der Spieler entschwunden ist (S. 570, ein tiefsinniger Ausklang des Buches). Schon der Titel „My Promised Land“ drückt im Grund den Glauben aus, dass dieses besondere Land vom Herrn aller Länder einem besonderen Volk verheissen worden ist.
Hier muss unsere christliche Gewissenserforschung ansetzen. Wo waren wir präsent mit unserem christlichen Zeugnis und Einsatz als Brückenbauer in dem von Shavit fazettenreich geschilderten dramatischen Geschehen? Mit der biblischen Botschaft, gründend auf den jüdischen Propheten, hätten wir den Schlüssel zur Lösung des Konflikts. Die „phänomenale historische Vision“, an der die Juden laut Shavit partizipieren, ist nichts anderes als die Vision Gottes, sein ersterwähltes Bundesvolk durch alle Untreue und Todesdrohungen hindurch wieder im „verheissenen Land“ zu sammeln, und zwar zum Segen für die Völker. Diese Vision Gottes gab auch unterschwellig der zionistischen Bewegung trotz den menschlichen Verirrungen die Kraft und den unglaublichen Durchhaltewillen, um gegen alle Hindernisse ein bis jetzt weiterlebendes Gemeinwesen aufzubauen. Aber damit Israel vor dem drohenden Abgrund bewahrt werden kann, braucht es unbedingt mit unserer christlichen Hilfe eine radikale Umkehr zu seinem Gott, dem Gott Israels.
Shavit schildert die neue israelische Jugend, die satt ist von der orthodoxen Gesetzestreue und des disziplinierten zionistischen Aufbauwillens und sich sagt: „In diesem Land geht es immer nur um Krieg und Tod. Sogar unsere Religion will uns nach unten ziehen, mit Jom Kippur und allem anderen. Ständig wird man aufgefordert, zu leiden und Opfer zu bringen. Doch jetzt haben wir etwas sehr Mächtiges, das sagt: ‚Zum Teufel damit!’ Wir müssen uns nicht mehr quälen und Opfer bringen. […] Es reicht. Es ist Zeit, Spass zu haben. […] Diese jungen Leute lesen nicht mehr Zeitung, aber sie tanzen wie verrückt. Sie ziehen nicht mehr in die Wüste und bauen keine Kibbuzim mehr, sie sind keine militärischen Helden, doch jagen sie wild hinter dem Glück und dem Vergnügen her“ (S. 424-426); wie die alten Israeliten, die sich, ihren Gott vergessend, dem orgiastischen Baalskult hingaben. – Dies ist ein gewaltiger Aufruf an uns Christen, jenen Getreuen in Israel, „die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal“ (1 Kön 19,18), fürbittend beizustehen und wie Mose Gott für sein Volk anzuflehen, damit er es von weiterem Unheil verschone (Ex 32,11ff).
Shavit sieht die Zukunft seines Landes düster: „Wir stehen vor einer Herkulesaufgabe.[…] Nach der Beendigung der Besetzung werden wir eine neue, feste und legitime eiserne Mauer auf unseren neuen Grenzen errichten müssen. Angesichts des Anschwellens des radikalen Islams muss Israel ein Land der Aufklärung werden. […] Der Kampf um unsere Existenz tobt weiter“ (S. 567f).
Shavit sieht die einzige Lösung im Rückzug aus den „besetzten Gebieten“ auf ein jüdisches von einer eisernen Mauer abgeschirmtes Ghetto, unter Aufgabe des jüdischen Stammlandes mit den Siedlungen, was praktisch unmöglich ist, schon wegen der Jerusalemfrage (s.u. Kap. 21).
Shavit schildert anhand ausführlicher Gespräche mit Siedlerführern mit Einfühlung ihre Vision, wonach sie sich berufen fühlen, im jüdischen Stammland, wo Gott zu Abraham sprach: „Deinen Nachkommen werde ich dieses Land übergeben“, den religiösen Zionismus gegenüber der säkularen Verflachung wieder zum Leuchten zum bringen. Mit der Besiedlung war laut Aussagen von Siedlungsführern „die Fackel [des säkularen] an den religiösen Zionismus weitergereicht worden. Und dessen Auftrag war es, Feuer auf den Berggipfeln zu entzünden. Eine einzige Siedlung auf dem Berg Schomron [wo die ersten Siedlungen entstanden] würde das Problem nicht lösen […], doch den Zionismus in eine ganz neue Richtung führen“ (S. 292). Die Siedler „möchten den Zionismus wiederbeleben und Israel retten […] aus der Erkenntnis heraus, dass der Staat Israel ohne spirituelle Tiefe keinen Bestand haben kann. […] Unser Weg ist der Weg unserer Väter, wir müssen uns ins Land der Väter zurückziehen, in die Berge, die wir verloren haben“ (S. 293). „Diese Pflicht erfüllte unsere Körper und unsere Seelen mit Energie, sie trieb uns an, unsere ganze Existenz“. „Ich führte ein Zwiegespräch mit Gott. Ich sagte zu ihm, was die Kinder Israels zu ihm sagten, wenn sie ihre Körbe mit Früchten aus der ersten Ernte in den Tempel trugen: ‚Hier, wir haben unseren Teil getan. Bitte, tu du den deinen und segne dein Volk, dein Israel’“ (S. 259).
Diese Siedler haben den Auftrag Gottes gut verstanden, aber tragischerweise nur zur Hälfte. Gott hat gewiss verheissen, sein Volk ins Land der Väter zurückzuführen, aber nicht um Konflikte zu provozieren, sondern zum Segen für die Einheimischen, ja für alle Völker. Dieser Mangel macht die Siedler geneigt zu Fanatismus, bis zu blutigen Terrorakten gegenüber Moslems und Christen. Es fehlt ihnen und auch Shavit der Glaube an eine mögliche Versöhnung, weshalb er als Lösung nur die Trennung mit einer „festen und legitimen eisernen Mauer“ (in Richtung einer „Zweistaatenlösung“ sieht.
Die Not mit den „Gebieten“ zeigt, dass sowohl der säkulare wie der religiös-jüdische Zionismus zwar in die richtige Richtung und dennoch an einen Abgrund führen ohne die Ergänzung durch einen „völkerverbindenden Zionismus“, wie ihn der Messias Israels und das Neue Testament aus den jüdischen Propheten uns erschliessen. Wie die jüdische „Heimkehr“ mit dem Zionismus Herzl’s nur dank der Vorarbeit christlicher Israelfreunde geschehen konnte, [21] so braucht es heute die Christenheit, damit das Ziel der Heimkehr, der Friede unter den Völkern rund um die Friedensstadt Jerusalem, erreicht wird, mit einem nicht fundamentalistisch verstanden „christlichen Zionismus“, von dem das folgende Kapitel handelt.
7. Christlicher Zionismus – Schreckgespenst oder Retter aus der Not – Zu den Beiträgen von Neuhaus und Kadelbach
Unter diesem Titel habe ich eine längere Antwort geschrieben an David Neuhaus, Sohn von Holocaustüberlebenden und jetzt Jesuit und Beauftragter vom Lateinischen Patriarchat in Jerusalem für die hebräischsprachigen Katholiken im Land. In seinem Buch „ Land, Bibel und Geschichte“ (Kulturverein AphorismA Trier 2011) prangert er eine fundamentalistisch verengte Version von christlichem Zionismus an und übersieht, dass viele Gruppen von Israelfreunden, die man als Bibelfundamentalisten verschreit, eine biblisch solid fundierte Theologie als Korrektiv zum politisch-nationalistischen Zionismus vertreten. Obwohl der Ausdruck „christlicher Zionismus“ missverständlich ist, drückt er trefflich aus, dass wir Christen berufen sind, die Juden auf dem Weg der Erfüllung der biblischen Verheissungen zu unterstützen, der hinzielt auf ihre äussere und innere Wiederherstellung auf „Zion“, zusammen mit uns, den Vertretern aus den Völkern. Uns Christen ist ein „völkerverbindender Zionismus“ aufgetragen als notwendiges Korrektiv zum jüdisch-politischen Zionismus, der die Gefahr in sich birgt, sich auf die äussere, politisch-nationale Wiederherstellung zu beschränken, und die Völker (Palästinenser) auszuschliessen. Leitbild ist die Vision Jes 2,1-6 von der Völkerwallfahrt (s.u. Kap. 14).
Neue Horizonte über die enge Verbindung zwischen dem Zionismus Herzl’s und dem christlichen Zionismus erschliesst uns das Buch des evangelischen Theologen Ulrich Kadelbach: „Zionismus. Christlich-jüdischer Wettlauf nach Jerusalem“ (Gerhard Hess Verlag 2015).
Obwohl der Begriff „Zionismus“ erst 1890 vom jüdischen Journalisten Nathan Birnbaum in Wien geprägt wurde, ist das damit Gemeinte ein in der biblischen Prophetie verwurzeltes Phänomen, das weit über Herzl zurückgeht, nicht nur bei Juden, sondern auch bei bibeltreuen christlichen Gruppen. Dazu gehört auch entfernt die katholische Bewegung der „Amici Israel“ (s.u. Kap. 20).
„Die weitverbreitete These, dass der Zionismus in seinen Anfängen eine rein säkulare Bewegung gewesen sei, lässt sich nicht unwidersprochen aufrecht erhalten. Der Zionismus ist im Kern die prophetische Vision von der Völkerwallfahrt zum Berg Zion, eine tiefe religiöse Verwurzelung eigener Existenz. Dies ist latent oder offen ausgesprochen auch das Selbstverständnis des Staates Israel. Eine rein politische Begründung würde der grossen Zahl der Freunde Israels unter Juden und Christen weltweit keineswegs genügen“ (Kadelbach S.270).
„Die erwachende christliche Sehnsucht nach dem Heiligen Land entsprang schon dem Pietismus im 18. Jahrhundert. Mit der Befreiung Palästinas durch Ibrahim Pascha 1831/32 begann der unaufhaltsame Zustrom von Europäern: Siedler, Handwerker, Pilger, Touristen, Mönche, Nonnen, Diakonissen und Missionare“ (S. 13).
Christliche Gruppen wie die pietistischen Templer wurden von den biblischen Verheissungen an das Volk Gottes bewegt, in das unter den Türken verwahrloste Palästina zu übersiedeln, um es durch Landwirtschaft, Handwerk und ihr Leben wieder gleichsam zum Aufblühen zu bringen, im Blick auf den kommenden Herrn und sein Reich.
Die Tempelgesellschaft ging 1859 aus der 1854 in Ludwigsburg gegründeten „Gesellschaft für die Sammlung des Volkes Gottes in Jerusalem“ hervor. Aus ihr ging 1859 die „Tempelgesellschaft hervor. 1869 trafen dann die ersten Siedler der Templer in Palästina ein. In der Folgezeit leisten sie, zusammen mit andern Siedlern, mit ihrer Landwirtschaft und ihren kulturellen Angeboten Grosses zur Kultivierung des Landes, zusammen mit den jüdischen Siedlern.
Geistiger Wegbereiter der Templer war der Theologe Christoph Hoffmann, mit seiner verbreiteten Zeitschrift „Süddeutsche Warte“ (ab 1845). „Sie diente in erster Linie dazu, die Gedanken an eine Zukunft im Land des wiederkehrenden Herrn weit im Volk bekannt und vertraut zu machen“ (S. 141). Darin schreibt Hoffmann:
„Das heilige Land soll nach der ausgesprochenen Bestimmung desselben dem heiligen Volke gehören. Ein solches Volk wollte Gott aus dem Volk Israel machen; darum gab Gott ihnen sein Gesetz, damit sie durch dasselbe sein vorzügliches Eigenthum vor den Völkern der Erde würden, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Da sie nun in Unreinigkeit und Sünde versanken, und das Land entheiligten, wurden sie ausgetrieben, wie es zuvor festgesetzt war. Dennoch blieb die erste Bestimmung unverändert, dass das heilige Volk das Land erben sollte. Das Land aber liegt wüste und öde und wird von den Feinden zertreten bis auf den heutigen Tag. Wo fehlt es? Es fehlt an einem heiligen Volk. Ein solches Volk zu sammeln, nicht allein aus den fleischlichen Nachkommen Israels, sondern auch aus denen, die in der ganzen Welt und unter allen Völkern sich vorfinden, das war der Zweck und die Aufgabe Jesu Christi, für welche er gestorben ist. Sein Tod wurde die neue Lebensquelle, aus welcher Israel und seine wahren Kinder geboren wurden … niemand anders kann zu dem heiligen Volke gehören, als wer aus Christi Blut ein neues Leben empfängt. […] Das heilige Volk ist Abrahams Samen. Nun gehören zu Abrahams Samen nicht nur die, die von der Beschneidung sind, sondern auch die, die da wandeln in den Fussstapfen des Glaubens Abrahams…“ (Süddeutsche Warte 1853, Nr. 28, S. 111).
Viele Christen aus den Grosskirchen empfinden diese auch in meinem vorliegenden Memorandum vertretene Israeltheologie als fundamentalistisch oder pietistisch im abwertenden Sinn. Sie besagt mit andern Worten: Gott ist dran, seine Heilsgeschichte zu vollenden mit der Wiederherstellung seines jüdischen Volkes im Land der Väter. Dazu gehört ihre Heimkehr, um das (unter den Türken) verödete Land wieder aufblühen zu lassen. Die Juden, denen die Verheissung immer noch gilt, können dies aber im vollen Sinn nur erreichen, wenn sie zu ihrem Messias und Erlöser heimkehren. Dazu braucht es die Mithilfe jener, die sich als Zugewanderte im Glauben Abrahams den Ersterwählten angeschlossen haben, um sie „eifersüchtig zu machen“ (Röm 11,11).
Das erreichten tatsächlich die christlichen Siedler: „Ein Movens [Antriebsstachel] für die zionistische Sammlung der Juden zum Aufbruch nach dem Heiligen Land war das starke Erwachen christlicher Zionssehnsucht. Weil pietistische Kreise sich selbst nun als das ‚wahre’ Volk Gottes verstanden und darstellten, war für die Juden ein weiterer Impuls für ihren ureigensten Anspruch auf das Heilige Land gegeben“ (Kadelbach S. 15).
Im Geist dieser pietistischen Siedler wirken heute auf andere Art unter den veränderten Umständen die vielen mehrheitlich evangelikalen Israelwerke. Statt Siedlungen zu bauen, zeigen sie durch ihre Präsenz, dass sie Israel in seiner Bedrohung zur Seite stehen und indem sie im Land völkerverbindende Projekte unterstützen.
Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760), eine Hauptgestalt des Pietismus und Gründer der bis heute weiterwirkenden Herrnhuter Brüdergemeine, hatte eine besondere Liebe zu den Juden und nahm 1741 die Fürbitte für alle Juden in ihr Sonntagsgebet auf. Er glaubte wie die geistesverwandten Puritaner an die bleibende Erwählung und Berufung Israels und dass die Judenchristen ihre jüdische Identität bewahren sollen. In diesem Geist betrieben die Herrnhuter in einfühlsamer Weise eine intensive Judenmission (Zinzendorf wollte sogar eine judenchristliche Gemeinschaft gründen). [22] Damit wollte er nicht die Juden von ihrem Judesein abbringen, sondern im Gegenteil sie zum Glauben an ihren Messias führen als Kern des auf alle Völker erweiterten neuen Israel.
Dies entspricht Zinzendorfs ökumenischer Weite, mit der er 1747 schrieb: „In jeder christlichen Konfession liegt ein gewisser Gedanke Gottes, der durch keine andere Konfession erhalten werden kann. Jede christliche Konfession hat ein Kleinod, das sie auf Gottes Befehl konservieren muss, wozu sie, so zu reden, den Schlüssel allein hat. Durch eine Konfession allein kann das Haus Gottes nicht gebaut werden, man muss sie zusammennehmen.“ – Heute sind wir „Heidenchristen“ allmählich dran zu erkennen: „Durch uns Völkerchristen allein kann das Haus Gottes nicht gebaut werden, wenn wir nicht unsere ersterwählten Brüder wieder in unsere Mitte aufnehmen.“
Möge uns Völkerchristen wieder dieses „pietistische“ Herz für die Berufung Israels geschenkt werden.
7.1. Die umstrittene „Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem“
Ein herausragendes Zeugnis des christlichen Zionismus in Israel ist die „Internationale Christliche Botschaft Jerusalem“ [23] Sie wurde 1980 in Jerusalem gegründet und vertritt rund 60 Staaten mit regionalen Zweigstellen. Das Ziel ist die Förderung der Solidarität aller Christen mit Israel und den Juden auf biblischer Grundlage durch finanzielle Förderung von Projekten, u.a. für Opfer des Holocaust, und durch Reisen nach Israel. Umstritten ist ihr Einsatz für die „Heimholung“ der Juden aus der Diaspora nach Israel. Anlass der Gründung war: Als 1980 Jerusalem vom israelischen Parlament durch das Jerusalemgesetz zur ewigen ungeteilten Hauptstadt Israels erklärt wurde, führte dies zu internationalen Protesten und zur Schliessung von 13 Botschaften in Jerusalem und ihrer Verlegung nach Tel Aviv. Etwa 1000 Christen aus aller Welt solidarisierten sich daraufhin mit Israel, indem sie am Laubhüttenfest teilnahmen, sich berufend auf Sach 14,16-19, wo gesagt wird, dass die Überlebenden aus den Völkern „Jahr für Jahr hinaufziehen, um sich niederzuwerfen vor dem König, dem HERRN der Heerscharen, und um das Laubhüttenfest zu feiern. Jene aber, die nicht hinaufziehen nach Jerusalem … auf sie wird kein Regen fallen.“ Seither ist das jährliche christliche Laubhüttenfest mit Tausenden von Teilnehmern aus aller Welt ein Grossereignis in Jerusalem mit prominenten jüdischen Rednern, die sich dankbar zeigen für dieses Zeichen christlicher Solidarität.
Manche jüdische Führer sehen, dass sie als Judenstaat gegen den Ansturm des Islam nicht überleben können ohne Unterstützung von Israel liebenden Christen. [24] Darum gibt es seit einigen Jahren einen offiziellen Knesset-Ausschuss für das Verhältnis zu christlichen Unterstützern Israels, den „Christian Allies Caucus“, der im Juli 2015 neu belebt wurde. [25]
Doch leuchtet es ein, dass dieses Zeichen christlicher Solidarität heftigen Widerspruch hervorruft von beiden Seiten. Die alten Kirchen, welche den Judenstaat als Fremdkörper empfinden, können nicht ertragen, dass die „Botschaft“ sich für die „Heimkehr“ der Juden einsetzt, obwohl sie auch Palästinenser unterstützt. Pater David Neuhaus lehnt ihre theologische Begründung unzutreffend als „fundamentalistisch“ ab (s.o. Kap. 7). Auf der andern Seite empfindet das israelische Oberrabbinat wie viele orthodoxe Juden die „Botschaft“ als unzumutbare „Judenmission.“ Das zeigt, dass unser christliches Zeugnis unter Juden eine Herausforderung ist, welche schon zur Zeit des Neuen Testamentes viele „zum Fall und zur Auferstehung vieler in Israel“ führte (Lk 2,34).
Gezielte „Judenmission“ ist eine Provokation, die kontraproduktiv wirkt. Die Christen haben sich durch die ganze Kirchengeschichte als inkompetent dafür erwiesen. Die berufenen Judenmissionare sind die messianischen Juden für ihre Volksgenossen. Wir Völkerchristen sollen aber mit Liebe und Weisheit Zeugen sein für den Messias Israels für seine ersteborenen Brüder und sie seinem Wirken überlassen. Was anstatt der Judenmission gefragt ist, ist das gegenseitige Zeugnis. Juden und Christen haben eine gemeinsame Mission füreinander und miteinander. [26]
8. Arabisches Unverständnis für die jüdische Sonderberufung
Wir haben das herzliche Willkomm von König Faisal für die “heimkehrenden Juden vernommen (s.o. Kap. 6). Von Seiten der einheimischen arabischen Kirchen fehlt(e) ein solch herzliches Willkomm. Im Gegenteil liess man sie von Anfang an spüren, dass sie nicht willkommene Besatzer sind. Es fehlte die Zusicherung, die zionistische Bewegung mit Wohlwollen (freilich im Geist Jesu und nicht politisch einseitig) begleiten zu wollen und zu einem guten Einvernehmen mit der muslimischen Bevölkerung zu verhelfen. Damit hätten sie der akuten Gefahr der zionistisch- nationalistischen Abriegelung entgegenwirken können. Tatsächlich barg der politische Zionismus die Gefahr des Zusammenstosses mit der einheimischen Bevölkerung, wie die israelischen zionismuskritischen „Neuen Historiker“ zeigen. [27]
„Doch auch diese übersehen das geistliche Grundproblem, den Islam. Denn auch Amin Al Husseini – der spätere Mufti von Jerusalem und Hitlerfreund - bekämpfte die Juden schon in den 20er Jahren mit dem Hinweis, dass es um den Erhalt der islamischen Herrschaft über jenes Gebiet ging“ (HPB).
Ausführlich stellt der deutsche Politwissenschafter Matthias Küntzel in vielen Schriften den enormen Einfluss der Nazi-Ideologie auf die arabische Einstellung zur Verhinderung des Israelfriedens ins Licht. Siehe www.matthiaskuentzel.de.
Der einheimischen Kirche fehlte die biblische Vision, dass Gott selber mit der Heimkehr der Juden ein Modell des Zusammenlebens der Völker mit seinem besonderen Eigentumsvolk schaffen wollte. Diese Kirchen sind, wie weitgehend die ganze Weltkirche, befangen von der oben dargestellten „Enterbungstheologie“. Darum gelten die Juden in ihren Stammlanden (Judäa und Samaria) den einheimischen Christen vielfach als illegale Besatzer und Störenfriede.
Diese antiisraelische Haltung kommt zum Ausdruck im „Kairos-Palästina-Dokument“ und in den „Christus-am-Checkpoint-Konferenzen“, welche den Judenstaat delegitimieren und die muslimische Gegenfront stärken. Voll hinter dem „Kairos-Palästina-Dokument“ steht der frühere Lateinische Patriarch Michel Sabbah. Sein Nachfolger Fuad Twal hat ein begeistert zustimmendes Vorwort zur italienischen Ausgabe geschrieben, ohne offenbar die darin enthaltene Irrlehre zu durchschauen.
Das Kairos-Dokument macht den Eindruck, dass alle palästinensischen Kirchenführer hinter diesem Dokument stehen. Doch in Wirklichkeit waren es nur der jetzt zurückgetretene Lateinische Patriarch Sabbah und der arabisch lutherische Bischof Munib Younan, der aber die Unterschrift zurückzog, als er Vorsitzender des lutherischen Weltbundes wurde. Von antiisraelischen Theologen wurden die Kirchenoberhäupter unter politischen Druck gesetzt, ihrer agitatorischen Linie zu folgen, wogegen sie sich wehrten, indem sie vier Tage nach dem Erscheinen des Kairos-Dokumentes eine kurze, eigene Verlautbarung erliessen, in der sie sich zwar mit dem Notschrei des palästinensischen Volkes verbanden, aber sich hüteten, antiisraelische Affekte zu schüren und Partei zu ergreifen. Im vollen Wortlaut:
„Wir, die Patriarchen und Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem, hören den Schrei der Hoffnung, den unsere Kinder in diesen schweren Zeiten geäussert haben. Wir unterstützen sie und stehen ihnen in ihrem Glauben, ihrer Hoffnung, ihrer Liebe und ihrer Vision für die Zukunft bei. Ausserdem unterstützen wir den Aufruf an alle unsere Gläubigen, an die Vertreter Israels und Palästinas, an die internationale Gemeinschaft und die Weltkirchen, die Bemühungen um Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung in diesem Heiligen Land zu beschleunigen. Wir bitten Gott, all unsere Kinder zu segnen und ihnen mehr Kraft zu geben um einen effektiven Beitrag zu leisten bei der Entwicklung und Errichtung ihrer Gesellschaft der Liebe, des Vertrauens, der Gerechtigke9it und des Friedens zu machen.“
Entgegen dem Kairosdokument ist dies alles andere als eine Befürwortung einer weltweiten Kampagne gegen den Staat Israel. Kein „Vergehen“ wird angesprochen und keine Schuld wird auf irgendjemand geworfen. Im Gegenteil, die Erklärung enthält Nichts, was Menschen guten Willens verletzen könnte. [28] Doch eben: trotz diesem guten Willen zum Frieden fehlt diesen Kirchenführern offenbar die rettende Vision der biblischen „Einstaatenlösung.“ Um niemanden zu verletzen scheut man sich aus politic correctness, den Hintergründen der Krise ins Auge zu schauen und die beidseitige Schuld beim Namen zu nennen. Dabei ist unsere erste Aufgabe Israel gegenüber nicht, ihm sein Fehlverhalten, unter dem viele Juden leiden, vorzuhalten, sondern es in seiner Sonderberufung zu ermutigen, was die Freiheit gibt, auch über Fehler offen zu reden, ohne zu verletzen.
Paradox ist: während die palästinensischen Kirchenführer sich vom antiisraelischen Kairos-Dokument distanzieren, haben es westliche christliche Gremien in ihr antiisraelisches Kampfprogramm aufgenommen wie der Ökumenische Weltkirchenrat, das katholische Werk „Pax Christi“ und andere führende Kirchenkreise in westlichen Ländern, welche zudem diverse antiisraelische Programme und Aktionen gegen Juden und Israel unterstützen. Dabei werden im Kairos-Dokument notorisch die Hetze und der Terror gegen Juden und Israel, inkl. die zur Vernichtung Israels ausrufenden Satzungen von PLO und Hamas ausgeblendet.
Das Kairos-Dokument möchte die Palästinensische Befreiungestheologie als authentisch biblische Friedensbotschaft in die Welt hinausposaunen. Dass sie diametral einer soliden Bibelauslegung widerspricht, haben Exegeten wie Klaus Wengst klar nachgewiesen. [29]
Auch Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff, der Beauftragte der deutschen Bischofskonferenz für den jüdisch-christlichen Dialog, erklärte in einer Konferenz, man müsse das Dokument „zunächst als Hilferuf der in vielfacher Hinsicht bedrängten christlichen Minderheit und als Schrei nach Gerechtigkeit lesen und verstehen. Allerdings wird man unschwer feststellen, dass die theologische Argumentation des Dokumentes mit der Entwicklung der katholischen Lehre, wie ich sie gerade skizziert habe, nicht in Übereinstimmung zu bringen ist.“ [30]
Wenn man diese Abweichung von der Lehre der Kirche und der Bibel nicht als Häresie bezeichnen möchte, ist sie doch wegen den schweren Folgen sehr ernst zu nehmen und ruft die Glaubenshüter zu einem klärenden Wort. Wenn auch die palästinensischen Kirchenhäupter sich um Frieden und Versöhnung bemühen, so zeigte doch die Nahostsynode (s.u. Kap. 18), dass für den Frieden mit Israel als Judenstaat noch ein starkes Umdenken im Sinn einer soliden Israeltheologie nötig und von den Glaubenshütern konziliär anzustreben ist (s.u. Kap.19.)
9. Der melkitische Patriarch Gregorios III.
Diese hervorragende geistliche Persönlichkeit zeigt, wie die „Enterbungslehre“, die durch Jahrhunderte die Kirchenführer in Bann hielt, auch heute noch Friedenssuchende wie mit einer Augenbinde blind macht (vgl. 2 Kor 3,14f).
Gregorios III. Laham , aus Syrien gebürtig, schloss sich im Libanon dem Orden der Basilianer an, wurde Patriarchatsvikar in Jerusalem, wo ich ihn kennenlernte, und wurde im Jahr 2000 Oberhaupt der griechisch-katholischen (oder melkitischen) Kirche, welche der ostkirchlichen (orthodoxen) Liturgie und Spiritualität folgt, aber mit Rom verbunden ist, also eine Brücke der westlichen zu den östlichen Kirchen bildet. Als ich im Organ des Schweizerischen Heiligland-Vereins (Nr. 4/1987) im Auftrag einen Artikel schrieb zum Thema „Rückkehr zu den Wurzeln – Christliches Umdenken in Bezug auf Volk und Land Israel“ und er das las, zeigte er sich, als ich ihn in Jerusalem besuchte, höchst erbost über meine Aussagen und verteidigte die „Enterbungslehre“. Freilich seien auch die Juden erwählt, „wenn sie sich uns anschliessen“, also Christen werden. Wie er mir bei späteren Begegnungen deutlich sagte, hätten die heutigen Juden, besonders in Israel nichts mit den biblischen Juden und ihren Verheissungen zu tun; sie seien ein Volk wie jedes andere, „ein Anhängsel Amerikas.“ Aus einem neueren Interview mit ihm referiert der Redaktor Jakob Hertach:
„Die grösste Gefahr droht der arabischen Welt mit der Aufsplitterung in sektiererische Gruppen. Gregorios nennt als Beispiel den Staat Israel. Mit der einseitigen Erklärung als ‚Judenstaat’ werden die Bedürfnisse der christlichen palästinensischen Bürger und der Muslime weitgehend ausgeklammert. Würde dieses Modell auf arabische Staaten angewendet, entstünden konfessionelle Ghettos: Sunniten, Schiiten, Alawiten, Drusen, Jesiden, jüdische und vielleicht auch christliche.“ [31]
Für den Patriarchen wie überhaupt für die meisten arabischen Kirchenführer sind also die Juden, besonders die Israelis, ein Volk wie andere Völker, die sich nationalistisch von andern abgrenzen. Diese Haltung ist gewiss keine Basis für die gegenseitige Annäherung der Blöcke.
Dass Israel kein Ghetto und Apartheidstaat ist, zeigt sich darin, dass viele Araber sich dort freier fühlen als in einem Islamstaat. Im Hadassa-Spital arbeiten jüdische und arabische Ärzte und Pflegeangestellte kameradschaftlich miteinander, während Mahmud Abbas in einer politischen Konferenz in Kairo gesagt hat, er wünsche das palästinensische Gebiet judenfrei.
Der geistlich hervorragende Patriarch Gregorios steht für die meisten arabischen Kirchenführer und Theologen und lässt die Dringlichkeit des römischen Lehramtes aufleuchten, um die dargestellte abweichende Haltung in einem konziliaren Prozess zu klären.
Ein weiteres Beispiel für Blindheit für die jüdische Sondererwählung mit der Landverheissung ist der hochrangige anglikanische Bischof und Paulusexeget N.T. Wright, der mit seiner „Erfüllungstheologie“ keinen Raum lässt für die noch ausstehenden endzeitlichen Verheissungen an das jüdische Volk und blind ist für die Zentralaussage des Paulus über die bleibende Sondererwählung der Juden. Nach PJS ist dies eine „polemische Verkürzung der sehr nuancierten Position von Wright.“ Doch können wir Wright damit entlasten, dass er in diesem Punkt immer noch unter dem Bann einer weiterhin stark verbreiteten „Erbkrankheit“ steht. Wright hat das grosse Verdienst, liberale Theologen wieder kraftvoll in die Mitte unseres Glaubens zu führen: zum Tod und zur Auferstehung unseres Herrn als Wendepunkt der Heilsgeschichte.
Wir können die Erfüllungstheologie Wright’s positiv so uminterpretieren: Gewiss hat Jesus am Kreuz mit dem Ruf „Es ist vollbracht“ die ganze Welterlösung grundsätzlich vollendet, auch die Verheissungen an Israel, aber mit dem Unterschied, dass die Erfüllung der letzten Phase dieser Verheissungen auf dem Weg zur Wiederkunft Christi noch aussteht, kraft seines Kreuzesopfers als „König der Juden“. Mit seinem Ruf: „Verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ hat er das Tor zur „Wiederherstellung Israels“ geöffnet. Das entspricht dem biblischen Zeitschema: „Die Stunde kommt und sie ist schon da“ (Joh 4,23): Jesus hat am Kreuz alles zur „Auferstehung und Verherrlichung“ seines Volkes vollbracht (Lk 2,32.34), doch die historische Verwirklichung der „Wiederherstellung Israels“ hat er auf die letzte Phase der Heilsgeschichte verschoben nach der vorgeschalteten Phase der Völkerevangelisation (Apg 1,6-8; Lk 21,24). Das kann man herauslesen aus dem Wort Jesu: „Letzte werden Erste sein und Erste Letzte“ (Lk 13,30; vgl. Mt 19,30). Die Erstberufenen sind die Juden (vgl. Apg 13,46; Röm 1,16), doch nun kommen ihnen die Glaubenden aus den Völkern zuvor, ebenso als Frucht des Erlösungsopfers Jesu. Wright steht nicht allein mit dem Unvermögen, das heutige Geschehen rund um die Juden im Licht der biblischen Wiederherstellungs-Perspektive zu sehen.
10. Das jüdische Stigma der Auserwählung
Eine Sondererwählung hat zwei Seiten. Einerseits kann sie überheblich machen und zur Geringschätzung und Benachteiligung der andern führen. Und umgekehrt provoziert sie den Neid und Hass der nicht Erwählten. Biblische Beispiele sind Isaak und Ismael, Esau und Jakob, Josef und seine Brüder. Andererseits ist die Sondererwählung etwas gutes, wenn sie als Erwählung zum Dienst an den andern verstanden wird. So ist Israel besonders erwählt und aus den Völkern ausgesondert als „Licht unter den Völkern“, als Wegbereiter des messianischen Reiches, als Sammelpunkt für alle Nationen. Wir Christen sind berufen, die Juden zu ermutigen, diese Aufgabe wahrzunehmen und dankbar zu sein für ihre Erwählung.
Viele säkulare Juden sind des Stigmas als besonders Auserwählte überdrüssig und wollen sein wie andere. Schon zur Zeit der Säkularisierung (19. Jh.) fanden es die gebildeten Juden als Befreiung, dass sie sich nun als freie Bürger wie alle anderen in die Gesellschaft integrieren konnten. Doch Gott will nicht, dass sein Volk sich nivelliert auf das Niveau der Völker. Das zeigte sich schon zur Zeit Samuels. Da kam über die Israeliten die Versuchung, sein zu wollen „wie alle andern Völker“ („Gib uns einen König…, wie es bei allen Völkern der Fall ist“, 1 Sam 8,5). Diese Haltung wurde den Juden bis heute öfters zum Fallstrick, denn Gott will sich sein Demonstrationsvolk durch alle Zeiten ausgesondert zu seinem besonderen Dienst erhalten, aber nicht indem es andere ausschliesst, sondern zum Segen für die andern Völker. Besonders schmerzlich erfuhren die deutschen Juden unter Hitler, dass die Anpassung sie nicht vor der Katastrophe bewahren konnte. Dies, obwohl sie sich als voll integrierte und nützliche Bürger gesehen hatten. Wehe dem Staat Israel, wenn er z.B. in der Selbstverteidigung mit Superwaffen sich verhält wie die westlichen Supermächte und nicht in erster Linie seinen Schutz und seine Weisung beim „Gott Israels“ sucht. Doch damit Israel seine Rolle als „Licht der Völker“ ausüben kann, bräuchte es die geistliche Unterstützung von uns Christen. Doch gerade darin versagen die einheimischen Christen durch ihr Unverständnis für die Berufung Israels.
Kraftvolle Impulse zur Sendung der Juden bietet der mutige Volkserzieher und prophetische Rufer F.W. Foerster in seiner 1959 erschienene Schrift „Die jüdische Frage. Vom Mysterium Israels“ (Herder Taschenbuch). [32] Foerster, der aus einer liberalen nichtreligiösen Berliner Familie stammt und die Wurzelkraft des jüdischen und christlichen Glaubens aus der Heiligen Schrift neu entdeckt hat, redet nicht nur den Christen ins Gewissen, sondern auch den Juden und mahnt sie, nicht zu werden „wie die Völker“, um „Licht zu sein für die Völker“.
Dass die Juden das auserwählte Volk bleiben, besagt nicht, dass sie besser sind als die andern. Nach der Umfrage des Guttman-Zentrums von 1999 waren in Israel 5% ultra-orthodox, 11% orthodox, 32% traditionell, 43% säkular, aber nicht antireligiös, 3% antireligiös. 67% glauben, dass die Juden das auserwählte Volk sind, 56% an das Leben nach dem Tod, 51% dass der Messias kommt. Orthodoxe, die sich ganz aufs Studium der Tora und der dazu gehörigen rabbinischen Tradition verlegen, gleichen manchmal den Schriftgelehrten zur Zeit Jesu, die ihn im Namen Gottes kreuzigen liessen (vgl. Joh 19,7). - Es bestehen grosse Spannungen zwischen den Säkularen und den Orthodoxen, die als Parasiten verschrien werden. Ein grosser Teil hängt noch irgendwie an der biblischen Tradition, doch nur ein kleiner Teil glaubt im Herzen an den Gott der Bibel. Mit der Kriminalität stehen die Israelis nicht besser da als die „christlichen“ Nationen. Mit den vielen Abtreibungen begehen die Israelis einen innerjüdischen Holocaust, wie es gläubige Juden sehen.
Doch lieben wir die Israeli nicht, weil sie besser sind als andere, sondern weil sie trotz ihren Fehlern ihrem Stande nach Gottes auserwähltes Volk bleiben, auch wenn sie es ihrem Zustande nach noch nicht sind. Durch unsere Liebe zu ihnen und unser Gebet können wir Steine aus dem Weg räumen, damit sie den Weg finden „zum Ziel, wohin Gott sie führen will.“ [33] Die Liebe öffnet die Augen für das Gute, das im jüdischen Volk durch alle Bedrohungen wächst, und macht demütig im Blick auf das eigene christliche Versagen.
11. Realistisch beide Seiten abwägen
Die Bücher der Israelkritiker bringen viel ernstzunehmende Fakten. Doch sie übersehen meist, dass die unheilvolle Entwicklung die Reaktion ist auf die wiederholten Vernichtungsversuche, beginnend schon vor der Staatsgründung. Im Vergleich zu den menschenverachtenden Angriffen der Hamas, die keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nimmt und ihre eigene Bevölkerung als Schutzschild für ihre Raketen opfert, reagiert die israelische Armee unter eigenen Opfern bedeutend zurückhaltender.
Das bestätigte zum Gazakrieg 2014 US-Generalstabschef Dempsy am 6.11.2014: “Ich denke, dass Israel ausserordentlich viel getan hat, um Kollateralschäden und zivile Opfer einzuschränken“ (HPB). Ähnlich der ehem. Britische Kommandant Kemp in Afghanistan zum Gazakrieg 2009 vor dem UN-Menschenrechtsrat am 16.10.2009.
Als nach Beendigung des britischen Mandates am 14. Mai der Staat Israel ausgerufen wurde, stürzten die Armeen der fünf anstossenden arabischen Länder ins Land, um den neugeborenen Staat in der Wiege „ins Meer zu werfen“. Die weiteren Vernichtungsversuche, u.a. im Sechstagekrieg, förderten weiter eine Abwehrhaltung der Israelis. Die Boykottaufrufe der Christen (die auch den Palästinensern schaden, da sie Arbeitsmöglichkeiten in den „Siedlungen“ verlieren), dienen gewiss nicht dem Frieden. Die für Israel ungünstigen Meldungen der Tagesmedien erscheinen in anderem Licht, wenn man sich bemüht, die Gegenseite zu konsultieren. Exemplarisch ist der Fall Mohammed al-Dura, ein sterbender Junge in den Armen des Vaters, angeblich getroffen von einer israelischen Kugel. Dieses Bild ging durch die Welt und demonstrierte die Unmenschlichkeit der Israelis. Als es sich dann herausstellte, dass es keine israelische Kugel sein konnte, verstummten die Medien. Nach PJS sind oft weder die arabischen noch die israelischen Berichte verlässlich.
Das gilt auch für die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem (www.btselem.org), welche besonders schuldhaft Übergriffe von Soldaten in den besetzten Gebieten anprangert, aber das Angebot ablehnt, mit den Verantwortlichen zusammenzuspannen. Sie stehen in der Linie jener jüdischen Intellektuellen, welche unter dem Unrecht ihres Volkes leiden und aus jüdischem Gerechtigkeitssinn mit übersteigerter Kritik an der eigenen Regierung sich auf diese Weise gleichsam bei den Völkern dafür entschuldigen und zeigen wollen, dass nicht alle Juden so sind.
Gewiss soll man sich auch die vielen grausamen Meldungen zu Herzen gehen lassen wie diese: „Bulldozzer der Besatzungsmacht entwurzelten (2015) auf der Farm des Daoud Nassar in der Nähe von Bethlehem eines Morgens ohne Vorwarnung 1500 Aprikosen- und Apfelbäume, die die Familie vor zehn Jahren gepflanzt hatte. Die Aprikosen waren reif und sollten in den nächsten Tagen geerntet werden… Die Besatzungsmacht hatte dieses Stück Land kurzerhand zu ‚Staatsland'’ erklärt, und damit war die Obstplantage des Daoud Nassar über Nacht ‚illegal’ geworden.“ [34]
Gewiss weckt dieses Vorgehen keine Sympathie für den jüdischen Staat, wie überhaupt die israelischen Politiker viel tun, um (potentielle) Israelfreunde abzustossen (z.B. mit Visabeschränkungen für israelfreundliche christlichen Werke oder mit Einlassverbot für Christen aus besetzten Gebieten zu den Hochfesten in Jerusalem). Doch auf solche Meldungen kann man auf zwei Arten reagieren: 1. Indem man gegen Israel hetzt und zum Boykott aufruft, oder 2. indem man klar das Unrecht beim Namen nennt, doch den Weg Jesu geht, der nicht gegen die harte römische Besatzungsmacht predigte wie die Zeloten, die damit ihr Volk in die Katastrophe führten, sondern mit den Römern freundschaftlich umging mit der Wirkung, dass das Römerreich nach der Zeit der Verfolgung zum Träger der christlichen Botschaft wurde. Statt zum eigenen Schaden gegen Israel zu hetzen, lehrt uns Jesus, aufbauend die guten, in diesem Memorandum gezeigten Ansätze zu unterstützen! Bemerkenswert ist die Äusserung einer gebildeten christlichen Palästinenserin: „Ich liebe die Juden, aber nicht die israelische Politik.“
Wie man einäugig antiisraelisch sein kann, zeigte mir das Mail eines Pastors, mit dem ich spirituell herzlich verbunden bin. Er ist in einer Gemeinschaft, die sich für die Einheit der Christen einsetzt, „mit Jesus in der Mitte“, und trotzdem mitwirkt bei antiisraelischen Anlässen. Er schreibt mir:
„Tatsächlich: was uns verbindet, ist der Wille, für die Einheit zu leben – was uns trennt, ist die unterschiedliche Beurteilung des Staates Israel und seiner brutalen Besatzungspolitik, die ein Verrat an den echten jüdischen Werten ist. Ich mache mir Sorgen um Israel – doch die Bedrohung kommt von innen, nicht von aussen. [Diese Sicht wird nach PJS von vielen jüdischen und arabischen Israelis geteilt.] – Aber ich bin mir bewusst, dass eine Diskussion in dieser Hinsicht fruchtlos ist. Und so lassen wir uns denn als Brüder in Christus in diesem Punkt unterschiedliche Wege gehen...“ – Mein politischer Gewährsmann HPB bestätigte mir, wie man bei Anlässen propalästinensischer Friedensaktivisten, die er öfters besucht, unfähig ist, auf die Gegenseite zu hören. - Möge mein Schreiben ein bisschen helfen, diese Kluft zu überwinden.
12. Ephraim Karsh: die Palästinenser von den Arabern verraten
Eine ausführliche Geschichte der von den Palästinensern verpassten Chancen bietet das Werk des jüdischen Historikers Ephraim Karsh „Palestine Betrayed“ (Verrat an Palästina). [35] Der Autor zeigt, wie alles nach den ersten jüdischen Einwanderungswellen aus Russland und Osteuropa (Ende 19. Jh.) hoffnungsvoll begann. Die Araber profitierten prächtig vom jüdisch-europäischen Fortschritt. Die Kindersterblichkeit sank, die Lebenserwartung stieg, Araber aus Nachbarländern wanderten in das bevölkerungsarme Land ein, weil sie Arbeitsmöglichkeiten fanden. Mit Begeisterung verkauften die Beduinen den Juden Wüsten- und Sumpfland zu stolzen Preisen. Palästinas Wirtschaft erblühte.
1922 hatte der Völkerbund die Umsetzung der Balfour-Deklaration, in Palästina eine „nationale Heimstätte für das jüdische Volk“ zu errichten, zum internationalen Ziel erklärt (nicht eine Staatsgründung; das hätten die arabischen Nationen nicht ertragen). Mit diesem Land, Erbe des Osmanischen Reiches, hatte jeder arabische Nachbar eigene grosse Pläne. Keiner der arabischen Nachbarn gönnte es dem andern, aus Angst um das Gleichgewicht in der Region. An der Friedenskonferenz in Versailles 1919 hatte keine arabische Nation Anspruch auf das „Palästina“ genannte Gebiet erhoben. Einen palästinensischen Staat hatte es nie gegeben. Am liebsten hätte man es beim status quo unter dem britischen Mandat belassen. Nur der von den Briten ernannte Mufti von Jerusalem, Amin Al-Husseini, sah seine Felle davonschwimmen und machte die „nationale Heimstatt“ der Juden zum islamischen Hass-Thema. Als dann nach Ausrufung des jüdischen Staates die Armeen der arabischen Nachbarländer einfielen, um den Judenstaat ins Meer zu werfen, drängten sie die Einwohner zur Flucht, denn „wenn die Araber sich bereit erklärt hätten, unter jüdischer Herrschaft zu leben, wäre das der stillschweigenden Anerkennung des jüdischen Staatswesens gleichgekommen“ (so Karsh). (Jetzt sind mehr als eine Million Araber Bürger des israelischen Staates.) Vergeblich bat der jüdische Bürgermeister von Haifa unter Tränen die arabischen Einwohner, als gleichberechtigte Bürger in der Stadt zu bleiben: „Wir Juden haben ein Interesse daran, dass ihr bleibt.“ Zur Flucht trieb die Palästinenser auch die Angst vor der angekündigten Invasion arabischer Armeen. [36] Bis 1967 herrschten Jordanier und Ägypten im Westjordanland bzw. in Gaza und hätten Gelegenheit gehabt, einem Palästinenserstaat auf die Beine zu helfen. Doch das wollten sie ausdrücklich nicht. Ägyptens Präsident Gamal Nasser erklärte: „Wir werden immer darauf achten, dass die Palästinenser nicht zu stark werden“. Der syrische Präsident Hafez Assad erklärte 1974 Palästina als „integralen Teil Süd-Syriens“ und war darum gegen einen Palästinenserstaat.
Aus diesen Angaben wird deutlich, dass nicht Israel der „Hauptfeind des Weltfriedens Nummer 1“ ist, und dass nicht die Zionisten die Hauptschuldigen dafür sind, dass ihre Heimkehr nicht zum Segen für die Einheimischen wurde.
13. Einer, der sich auskennt: Johannes Gerloff
Gerade zum Thema Nahostkonflikt gehen die Meinungen weit auseinander. Da ist es wichtig, seine Informanten gut auszuwählen, um sich nicht von der Mehrheitsmeinung verführen zu lassen.
Als versierten Kenner des Nahostkonflikts und seiner Hintergründe empfehle ich Johannes Gerloff, Nahostkorrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP und der Nachrichtenagentur www.israelnetz.com. Er lebt seit 1991 in Jerusalem und steht in persönlichem Kontakt mit Juden und Arabern aller Richtungen. Als Theologe und Bibliker vermag er das Geschehen auch aus der höheren Perspektive zu deuten. In einem Interview mit Michael Herwig [37] bringt er frisch von der Leber weiterführende Einsichten zu unserem Thema.
Die Verhaltensweise der israelischen Juden und ihrer Politiker kann man weitgehend verstehen aus ihrer jahrhundertealten Bedrohtheit. „In Israel kann nur überleben, wer sich durch Stärke behaupten kann. Die israelische Gesellschaft ist eine Ellbogengesellschaft wie kaum eine andere […]. Der Grund für diesen Zustand und diese Einstellung liegt in der Gesamtlage des islamisch dominierten Nahen Ostens sowie in den Erfahrungen, die das jüdische Volk durch Jahrtausende hindurch, besonders konzentriert während des Zweiten Weltkriegs machen musste: die Erklärungen, das jüdische Volk zu vernichten, sind ernst gemeint -–und wenn es jemandem gelingt, diese Absichtserklärungen in die Tat umzusetzen, kümmert das niemanden. Im Ernstfall sind wir auf uns allein gestellt. Niemand wird uns helfen […]. Diese Einstellung [„vieler Israelis, die allerdings Gott sei Dank wohl nicht zutreffend ist“, PJS] prägt die Gesellschaft, prägt den Umgang der Menschen hier miteinander in vielen Bereichen – und prägt ganz besonders das politische Leben. In so einem Umfeld ist es möglich, dass Freunde über Nacht Gegner werden. Andererseits ist es aber auch möglich, dass Politiker, die sich gegenseitig furchtbar verleumdet haben, innerhalb kürzester Zeit zu Verbündeten werden, die ein gemeinsames Ziel verfolgen […]. Und dann ist noch ein Faktor in der israelischen Psyche, der nicht übersehen werden sollte: So sehr sich Israelis… hassen und streiten können – so sehr werden sie in einem Krisenfall zusammenstehen; so sehr fühlen sie sich, besonders in einem fremden oder gar feindlichen Umfeld als Familie“ (a.a.O. S. 5f). Das erklärt den überraschenden Wahlsieg Netanjahus im Mai 2015 als eindeutigen Vertrauensbeweis der Bevölkerung. (Seine Likudpartei machte einen Sprung von 18 auf 30 Sitze in der Knesset.) Der Grund dafür ist, weil Netanjahu das Hauptgewicht auf die politische Sicherheit legt (zu Ungunsten des sozialen Wohles des Volkes, besonders der Armen). Doch anderseits zeigte das harte Gerangel um die Regierungsbildung die innere Zerrissenheit und Verunsicherung des Volkes.
Der Eindruck der Bedrohtheit konnte verstärkt werden von der Meldung des israelischen Magazins www.jewsnews.co.il vom 12. Juli 2015 unter dem Titel: „Der Vatikan wünscht, dass der Tempelberg den Juden weggenommen wird“ (The Vatican Wants The Temple Mount Taken From The Jews). Weiter: „Täusche dich nicht, Volk [Israel], das Hauptanliegen des Vatikanstaates hinsichtlich Jerusalem ist es, es den Juden wegzunehmen und den Palästinensern zu übergeben.“
Ich bin ausgegangen von der Schilderung Gerloffs vom jüdisch-israelischen Grundtrauma der Bedrohtheit und des Alleingelassenseins, was sich auswirkt in einer als Überheblichkeit und Härte wirkenden Wehrbereitschaft. Um diese Härte abzubauen, hiesse die biblische Antwort:„Tröstet, tröstet mein Volk“ (Jes 40,1). Nach diesem Motto handeln viele Israelwerke. Die „Internationale christliche Botschaft Jerusalem“ hat es als ihr Leitwort gewählt (dazu s.o. Kap. 7,1.). Das bedeutet nicht, die aktuelle Israelpolitik kritiklos zu unterstützen, sondern Israel gegen seine Feinde zu helfen, seine Sendung als „Licht der Völker“, zusammen mit uns Christen zu erfüllen und es spüren zu lassen, dass sie „immer noch von Gott geliebt sind um der Väter willen“ (Konzil).
Zur Zweistaatenlösung sagt Gerloff: „Es gibt hier im Nahen Osten kaum noch jemanden, der auf eine Zwei-Staaten-Lösung hofft. Für gläubige Muslime, die der heute im Nahen Osten dominanten Koran- und Hadithenauslegung anhängen, ist sie aus religiös-ideologischen Gründen unmöglich. Säkulare, aber auch religiöse Palästinenser geben im privaten Gespräch nicht selten unumwunden zu, dass ein Palästinenser nirgendwo im Nahen Osten und Nordafrika so viele Freiheiten, so viel Rechtssicherheit, so viele Entwicklungsmöglichkeiten hat wie unter israelischer Herrschaft. Israelis wünschen sich von ganzem Herzen, die Palästinenser los zu sein, und haben das Besatzerdasein gründlich satt. Aber ein souveränes Palästina fünf Kilometer von Jerusalem und 20 Kilometer von Tel Aviv entfernt, das von einer Mischung der Geisteshaltungen regiert wird, die wir heute in Nordafrika, dem Gazastreifen, dem sogenannten Islamischen Staat und dem Iran sehen, kann und will sich niemand vorstellen. Es gibt kein arabisches oder islamisches Land, das momentan als Modell für ein Palästina herhalten könnte, das auch nur im entferntesten für Israelis akzeptabel wäre“ (S. 6).
Auf die Frage nach Hoffnungszeichen in dieser für säkulare Augen hoffnungslosen Lage für das Überleben des Staates Israel, antwortet Gerloff:
„Praktisch alle Israelis, die zu den Kreisen um [Präsident] Rivlin und Netanjahu gehören, haben arabische Bekannte und Freunde. […] Es gibt nicht nur israelfeindliche Araber, sondern die Araber, die nicht nur zionistische Parteien wählen, sondern sich auch in solchen wählen lassen […], werden oft übersehen. [...] In den letzten Jahren wurden die Stimmen von christlichen Arabern, die teilweise schärfere Gegner des jüdischen Staates sind als ihre muslimischen Volksgenossen, laut, die eine Wehrpflicht für ihre Jugend in der israelischen Armee fordern. Dabei hört man nicht nur, wie ‚Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft' ’vom ‚heiligen Staat Israel’ sprechen, sondern auch, dass es die Christen in dreissig Jahren nicht mehr geben wird, wenn sie nicht jetzt an der Seite der Juden zu den Waffen greifen [um besser in die jüdische Gesellschaft integriert zu werden, TM].“ Dies wird freilich von der arabisch-christlichen Hierarchie, denen die Solidarität mit ihren muslimischen Volksgenossen wichtiger ist, als jene mit ihren „erstgeborenen Brüdern“, nicht gerne gehört.
„Ein weiterer Aspekt ist, dass momentan in der islamischen und arabischen Welt eine atemraubende Erweckung hin zu dem Erlöser Jesus stattfindet. Interessant ist dabei, dass Muslime, die Jesus begegnen, nicht selten eine irrationale, aber tief gehende Liebe zum Volk Jesu bekommen. Und dann entdecken sie Jesaja 19 mit der Verheissung, dass die Völker des Nahen Ostens gemeinsam mit Israel ein Segen für die ganze Welt sein sollen.“
„Diese Bewegung lenkt unseren Blick auf den Einen, der allein Frieden bringt: Jeschua, der König von Israel. Erst wenn er kommt und den Völkern Frieden gebietet, wird Frieden werden. Alles, was davor geschieht, ist im besten Falle gutes Konfliktmanagement. Das gilt nicht nur für das Verhältnis Israels zu seinen Nachbarn, sondern auch für die Verhältnisse in Europa und Amerika“ (Zitate aus a.a.O. S. 9).
„Netanjahu scheint mit Konfliktmanagement zufrieden zu sein, mit verheerenden Folgen auch für das Zusammenleben von Juden verschiedener Richtungen“ (PJS). Mit hartem Konfliktmanagement dürfen wir uns nicht zufriedengeben, sondern müssen schon vor dem zweiten Kommen Jesu Wege suchen, damit schon in unserer Zeit der Friede Christi in Liebe aufleuchten kann, so wie in der Apostelgeschichte auf Zeiten der Verfolgung Zeiten des Friedens folgten (Apg 9,31).
14. Das Leitbild der Völkerwallfahrt bei Jesaja
Nicht nur den arabischen Kirchenführern, sondern auch vielen christlichen Organen im Westen fehlt die prophetische Sicht des Planes Gottes mit dem „Judenstaat“. Das biblische Modell ist die Völkerwallfahrt von Jes 2,1-5. Durch den Sohn der Jungfrau, den „Friedensfürsten“, wird, wie das Buch Jesaja weiter ausführt[38], das messianisch erneuerte Jerusalem zur geistigen Heimat für alle Völker, zum „Haus des Gebetes für alle Völker“ (Jes 56,7; Mk 11,17), nachdem schon der salomonische Tempel einen „Vorhof der Heiden“ für die „Gottesfürchtigen“ aus den Völkern hatte. Nun aber hat Jesus mit seinem Tod die Trennwand niedergerissen, welche die Heiden unter Todesstrafe hinderte, ins Heiligste einzutreten (Eph 2,14). Dass dieses Ziel noch nicht erreicht ist, zeigt sich drastisch auf dem Tempelberg, den die Israelis aus goodwill den Muslimen zur Verwaltung überlassen haben. Dort verehren die Juden ihre heiligste Stätte, wo ihr Tempel stand, in dem auch Jesus dem Vater dargebracht wurde und seine Lehrtätigkeit beendete: dort werden die Juden manchmal von islamischen Aufsehern mit Hassausbrüchen und Gewalt gehindert, öffentlich zu beten. Auch Christen müssen ihre Bibeln verbergen und dürfen nicht öffentlich beten, im Unterschied zum übrigen Jerusalem, wo unter israelischer Souveränität alle Kirchen ihren Glauben frei ausüben und bekennen können, zusammen mit den messianischen Juden, die bezeugen, dass Jesus hier Juden und Nichtjuden aus den Völkern verbindet. Damit beginnt sich die Psalmbitte zu erfüllen: „In deiner Huld tu Gutes an Zion, bau die Mauern Jerusalems wieder auf!“ (Ps 51,20).
Das letzte Buch der (christlichen) Bibel, die Johannesoffenbarung, zeigt am Schluss, wie das Leitbild der Völkerwallfahrt ins neue Jerusalem sich erfüllt durch das Blut des Lammes, das im neuen Bund Juden und Völker zu einem einzigen Gottesvolk verbindet. Gesondert und doch vereint ziehen die 144'000 aus den zwölf Stämmen Israel und die Unzähligen aus allen Völkern dort ein (Offb 7,4-10).
Dass man „nichts Böses mehr tun wird auf meinem heiligen Berg“ (Jes 65,25) ist noch lange nicht erreicht. Israel sei ein „Unrechtsstaat“, wie die jüdisch-katholische Anwältin Lynda Brayer mit ihrer „Society of St. Yves“, welche Palästinenser an der Knesset verteidigt, aus Erfahrung sagt. Doch das ist unter der derzeitigen Bedrohung nur schwer möglich, doch verglichen mit arabischen Ländern ist Israel immer noch von hoher Rechtlichkeit. Auch Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs werden missachtet! Arabische Bischöfe werfen dem Staat vor, dass er die Christen nicht gebührend vor den Anschlägen muslimischer und jüdischer Fanatiker schützt. Umgekehrt hüten sie sich, den Hass und Terror ihrer muslimischen Volksgenossen zu verurteilen, um ihr Wohlwollen nicht zu verlieren.
Dabei ist zu betonen, dass die Lage der Christen in Israel gut und gesichert ist im Vergleich zu den Christen in den palästinensischen Gebieten, wo sie sich von der Übermacht der Muslime bedrängt fühlen und darum auswandern, wenn sie können.
Israel würde gewiss den Christen mehr entgegenkommen, wenn es die Christenheit stärker auf seiner Seite wüsste und nicht ständig von ihr delegitimiert würde. Obwohl noch keine volle rechtliche Gleichberechtigung zwischen Juden und Nichtjuden erreicht ist, gibt es das Phänomen, dass demokratisch gewählte arabische Richter an der Knesset hohe israelische Politiker verurteilen konnten. Wo gibt es das in einem Islamstaat?
15. Die Rolle des Islam
Der Grundlagenvertrag der palästinensisch-vatikanischen Vertretung zur „Zweistaatenlösung“ zwingt uns, einen kritischen Blick auf den Islam zu werfen. Überhaupt steht die Unkenntnis gegenüber der Berufung Israels in innerem Bezug zur Unkenntnis über das Wesen des Islam. Das Konzil bemühte sich nach Jahrhunderten der Zwietracht um ein freundliches Verhältnis zu den Muslimen: „Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten…“ (Nostra aetate 3). Gewiss beten alle Muslime, die es mit lauterem Herzen tun (es gibt viele solche!), „den alleinigen Gott“ an. Doch davon zu unterscheiden ist Allah, wie er sich im Koran ausdrücklich bezeugt als Gegengott gegen den jüdisch-christlichen Gott, der als liebender Vater seinen Sohn hingab, um uns als seine Kinder erlösend zu sich heimzurufen (vgl. 1 Joh 4,3). An seinen Früchten erkennt man den wahren Gott. Am IS-Terror, der sich ausdrücklich auf Allah beruft, der im Koran öfters aufruft: „Tötet sie, die Ungläubigen (Juden und Christen)“, kommt deutlich der Widersacher zum Zug, wie schon bei den Gegnern Jesu, die meinten, Gott die Ehre zu erweisen. Ihnen musste Jesus sagen: „Ihr habt den Teufel zum Vater, und ihr wollt tun, was er begehrt“ (Joh 8,44). Dieser „Mörder von Anbeginn“ (vgl. 1 Joh 3,8) war deutlich am Werk im Leben Mohammeds [39] und in der islamischen Eroberungsgeschichte. Freilich hat auch in der Kirchengeschichte der Widersacher stark mitgemischt, aber im Islam hat er vermittels des Virus im „heiligen Koran“ einen besonders leichten Zugang. Wache Katholiken fordern darum unsere Glaubenshüter auf, die Konzilserklärung, die nur die positive Seite des Islam sieht, zu differenzieren. Der Unterschied zwischen dem Gott der Offenbarung und dem Allah des Koran darf nicht verwischt werden. Der christliche Gott ist ein Gott der sich verschenkenden Liebe, darum dreifaltig. Dem entgegen ist der Allah des Koran ein monolithisch-einsamer Gott, zu dem man keine Kind-Vater-Beziehung pflegen kann, woraus keine barmherzige Mitmenschlichkeit wachsen kann. Wesentlich für unsere Beziehung zu den Muslimen ist die Unterscheidung zwischen den Muslimen als von Gott geliebten Personen, denen gegenüber wir durch unser Verhalten den Gott der Liebe zu bezeugen haben, und dem Islam als Religion, wie er im Koran bezeugt ist. Viele Muslime sind offen für eine solche „Freundschaftsevangelisation“.
Viele Christen verharmlosen die genannte Dunkelseite mit der Aussage, der Islam sei an sich eine friedliche Religion; der im Namen des Islam geführte Terror habe nichts mit dem „wahren Islam“ zu tun (so auch Papst Franziskus). Doch immer mehr melden sich echte Islamkenner, welche uns tiefer in die Entstehung und Hintergründe des Islam aufklären. Nun hat der IS-Terror vielen Muslimen die Augen geöffnet und ihnen gezeigt, dass der Allah des Koran nicht der wahre Gott sein kann und sie offen gemacht für die Botschaft Jesu. Siehe dazu die Kronzeugin Sabatina James, welche den „wahren Islam“ unter Schrecken erlebt hat, oder den ehemaligen Islamprofessor an der Al-Ashar-Universität in Kairo, Mark Gabriel, der den Islamterror mit Folter an der eigenen Haut erfahren hat und nun in versöhnlichem Geist Jesu auf seinen Tourneen über den „wahren Islam“ aufklärt. Wie er im Buch „Swislam“ [40] erklärt, bedeutet Islam Unterwerfung, nicht Frieden.
Die Folgerung daraus für die Vatikanpolitiker und den christlich-muslimischen Dialog ist, anzuknüpfen beim allgemein menschlichen Verlangen nach Liebe und zu erspüren, wie wir diskret die christliche Friedensbotschaft einbringen können.
Im Gespräch mit Muslimen soll man freundlich ins Spiel bringen, dass im Koran das Land Israel (mit Judäa und Samaria) von Allah für immer den Juden anvertraut ist.
So schreibt der Islamkenner Heinz Gstrein [41]: „Alle islamischen Koranerklärer seit frühester Zeit stimmen darin überein, dass mit diesen Versen (Sure 5, 20-26, dazu kommen 2,251; 7,137; 10,93; 21,70f; 28,5f)) Israel als Land anerkannt ist, das den Juden gehört – ein Geburtsrecht, das ihnen gegeben wurde.“ Ein angesehener islamischer Korankommentar aus dem 14. Jh., der „Tsafir Ibn Kathir“, bekräftigt die Unwiderrufbarkeit der Landübergabe an die Juden. „Ibn Kathir geht sogar so weit, den Juden das Recht auf einen ‚Heiligen Krieg’ (Dschihad!) zuzusprechen, um Israel in Besitz zu nehmen und zu verteidigen. Das langjährige Herumirren des Volkes Israel in der Sinaiwüste wird sogar als Strafe dafür verstanden, dass es sich so lang weigerte, diesen göttlichen Auftrag zum Dschihad anzunehmen und zu vollziehen.“
Ein starker Vertreter des islamischen Zionismus ist Abdul Hadi Palazzi, der Generalsekretär der italienischen muslimischen Vereinigung und Direktor des Kulturinstituts der italienischen Muslime. [42] Er hat wie Mark Gabriel an der Al-Azhar-Universität in Kairo studiert und schreibt: „Israel ist der einzige moderne Staat, dessen Existenz eine Erfüllung von Prophezeiungen ist, die sich sowohl im Koran wie in der Bibel finden“. Der Koran lehre ganz eindeutig einen dreifachen Bund Allahs mit den Juden, in dem Land, Thora und Volk unlöslich zusammengehören. Der Land-Pakt bedeute, dass Gott das Land den Kindern Israels gab. Der Thora-Bund bedeute, dass das jüdische Volk treu nach der Thora leben und im Land Israel leben solle. „Zionist zu sein hat mit Gerechtigkeit zu tun“, so Palazzi. Dieser Imam verweist auf viele andere Islamgelehrte, die dasselbe lehren, z.B. Umair Ahmed Ilyasi, der Vorsitzende der indischen Imame.
Das Gesagte zeigt deutlich, dass der nächste Schritt zum Frieden im Nahen Osten gewiss nicht das blinde Erzwingen eines Palästinenserstaates ist, der nach Abwägen aller historischen und ideologischen Faktoren nicht als friedlicher Partnerstaat des „Judenstaates“ existenzfähig ist, sondern der Weg, der uns von der Bibel vorgezeichnet ist. In Israel selber gibt es Pioniergruppen, in denen sich Juden und Araber nach früherer Feindschaft im Namen Jesu freundschaftlich verbunden haben und demonstrieren, wo der wahre Friede zu suchen ist.
Beispiel dafür sind die beiden ehemaligen Todfeinde Taysir Abu Saada und Moran Rosenblit. Der erste war Scharfschütze bei der PLO. Sein Motto: „nur ein toter Jude ist ein guter Jude“. Die übernatürliche Begegnung mit Jesus änderte Taysirs Leben 1993 total. Radikalität ist immer noch einer seiner Charakterzüge: als wiedergeborener Christ predigt er heute angeblich sogar in Moscheen (?) das Evangelium Christi.
Moran Rosenblit erlebte als israelischer Soldat, wie seine Armeeeinheit durch zwei Selbstmordattentäter 22 israelische Soldaten verlor, sieben davon seine persönlichen Freunde. Diese schrecklichen Ereignisse trieben ihn noch weiter von Gott weg und liessen seine Abneigung gegenüber den Arabern so weit wachsen, dass er befand: „Nur ein toter Araber ist ein guter Araber“. Durch das Zeugnis von befreundeten messianischen Juden nahm er einige Zeit später Jesus in sein Herz auf. Jahre später traf er Taysir Abu Saada mit dem er seither befreundet ist und mit ihm auf Tournee geht, auch in der Schweiz, wo ich ihnen mehrmals begegnet bin.
16. „Bekehrung zu Israel“ notwendig
Für traditionelle arabische Christen braucht es meist eine Art Bekehrung, um die Juden als das, wozu sie Gott berufen hat, anzuerkennen, als sein besonderes „Eigentumsvolk“, das berufen ist, zusammen mit uns „Heidenchristen“ ein Modell des versöhnten Zusammenlebens zu bilden.
Auch die meisten übrigen Christen brauchen eine „Bekehrung zu Israel“, wie der päpstliche Prediger und Kapuziner Pater Raniero Cantalamessa vor 3’000 Teilnehmern der Konferenz „Jesus 2000“ in Nürnberg sagte. Auch er hatte die gewohnten Vorurteile gegen die Juden, doch dann ist ihm beim Betrachten eines Schriftwortes gnadenhaft aufgegangen,„dass ich mich zu Israel bekehren musste, zum Israel Gottes, wie es der Apostel nennt“. Dieses Israel sei zwar„nicht identisch mit dem politischen Israel, kann jedoch auch nicht davon getrennt werden“. [43]
In anderem Zusammenhang schreibt Cantalamessa: „Die Wiederherstellung der jüdischen Nation ist ein wunderbares Zeichen und eine Chance für die Kirche selbst, deren Wichtigkeit wir noch gar nicht in der Lage sind zu erfassen“. [44]
Dass „die fortdauernde Existenz des jüdischen Volkes, seine Heimkehr in das Land der Verheissung und auch die Errichtung des Staates Israel Zeichen der Treue Gottes [zu seinen Verheissungen] gegenüber seinem Volk sind“, proklamierte 1980 die Rheinische (evangelische) Synode, wovon sich heute allerdings etliche evangelische Theologen distanzieren. – Haben auch unsere katholischen Glaubenshüter die Wichtigkeit dieses Zeichens erkannt und das Volk darüber belehrt?
17. Der in der messianischen Bewegung neu aufblühende Feigenbaum
Israel wird in der Bibel verglichen u.a. mit einem Feigenbaum. [45] Erschütternd ist die Szene, wo Jesus den Feigenbaum verflucht, weil er an ihm keine gute Frucht findet, Bild für das Volk Gottes, das den Glauben verweigert und Gottes Sehnsucht enttäuscht, von seinem Volk reife Früchte der Gegenliebe und Treue zu ernten, wie es das Weinbergslied Jes 5,1-7 ausdrückt.
Viele verstehen die Geschichte vom verdorrten Feigenbaum („In Ewigkeit soll keine Frucht mehr an dir wachsen“) als Beweis, dass Israel nun für immer verflucht ist. Doch der „Zionist“ Lukas kennt eine andere Variante: „Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume! Wenn sie ausschlagen, und ihr seht es, wisst ihr von selbst, dass der Sommer schon nahe ist. Genau so sollt ihr, wenn ihr dies alles geschehen seht, wissen, dass das Reich Gottes nahe ist… Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen“ (Lk 21,29-32). - Der Feigenbaum, Bild des Volkes Israel (Lk 13,6f), figuriert hier nicht als verfluchter und verdorrter, sondern als der nach der „Auszeit“ des Winters neu Aufsprossende, Bild dafür, dass Gott sein Volk wieder neu aufblühen lässt, wenn seine Strafzeit abgebüsst ist (Lk 13,35; 21,24). [46]
Wer die „Zeichen der Zeit“ (Lk 12,56) zu deuten weiss, sieht, wie heute der durch Jahrhunderte abgestorben scheinende Feigenbaum Israel wieder neu aufblüht, nicht nur im Wunder der äusseren Wiederherstellung als Volk im Land der Väter, sondern noch mehr in der wachsenden messianischen Bewegung, in der Juden auf der Basis des jüdischen Neuen Testamentes zum Glauben an Jesus kommen und sich als neuauflebende jüdische Muttergemeinde verstehen.
Die Zahlenangaben über die messianischen Juden gehen weit auseinander. Nach eineer vorsichtigen Schätzung gibt es in Israel über 15'000, in USA 40'000, in Deutschland 2'500, weltweit von 15 Millionen Juden 120'000, mit steigender Tendenz. [47]
Innerhalb dieser Bewegung beschäftigt uns besonders die Bewegung TJC-II (Toward Jerusalem Council II = Dem zweiten Jerusalemkonzil entgegen). [48] Sie geht zurück auf eine Vision von Marty Waldman (1995), dem damaligen Präsidenten der „Union of Messianic Jewish Congregations“ in den USA. Er beschreibt die Entstehung so:
„Während ich mich intensiv mit dem Apostelkonzil in Jerusalem (Apg 15) beschäftigte, begann der Herr, mir die Notwendigkeit eines zweiten Konzils nahezubringen, das die Bollwerke des Antisemitismus und der Trennungen im Leib des Messias einreissen würde, um so die Einheit wiederherzustellen und zur Heilung tiefer Wunden beizutragen.“
Diese Bewegung sucht die Einheit der jesusgläubigen Juden mit den alten und neuen Kirchen im einen Leib Christi sichtbar zu machen, wobei der jüdische Teil sich nicht einfach einer alten Kirche anschliesst und dort aufgeht, sondern dem Modell von Eph 2,11-22 folgt, wo der jüdische Teil nicht einfach unter den „Heidenchristen“ verschwindet, sondern in seinem jüdischen Charakter als Zeichen der Treue Gottes erhalten bleibt.
Katholischer Verbindungsmann dieser Bewegung zum Vatikan ist Kardinal Christoph Schönborn; Koordinator für Europa ist sein Hauptdiakon Johannes Fichtenbauer.[49]
Papst Franziskus, der Freundschaften mit Rabbinern pflegt, lernte diese Bewegung kurz bevor er ins Konklave ging kennen und erkannte darin das Werk Gottes.
Durch Vermittlung der Kardinäle Schönborn und Cottier entstanden gute Beziehungen dieser Bewegung zum Vatikan. Der messianische Leiter Benjamin Berger in Jerusalem und sein Bruder Ruben erzählen in ihrer Autobiographie, wie es 1998 zur Privataudienz mit Papst Johannes Paul II. kam. „Seine Hand zitterte, aber er war ganz wach im Geist. Er stellte uns viele Fragen… Ich denke, dass damals im Vatikan ein Bewusstsein für die messianische Bewegung entstand… Wir haben auch über den Antisemitismus gesprochen und erzählt, wie die Kirche im Laufe der Geschichte für die Juden zum Stolperstein wurde, der sie abhielt, an Jesus zu glauben.“ [50] Von da an geschahen periodisch Treffen von ca. 20 Vertretern der TJC-II-Bewegung (messianische Gläubige und Katholiken aus verschiedenen Ländern) mit Vatikanzuständigen, abwechselnd in Rom und in Israel.
Dieser gute Anfang ist aber noch lange nicht bis in die Basis der Kirche bekannt geworden. In einem in Israel erschienenen Nachschlagebuch über die vielen Kirchen (Konfessionen) im Heiligen Land existiert ausgerechnet die messianische Bewegung, welche gewissermassen das Neuaufleben der jüdischen Muttergemeinde darstellt, nicht. Dies ist zwar begreiflich, da diese Bewegung noch ziemlich diffus ist, aufgesplittert in viele Gruppen. Doch zeigt dies, dass der Sinn für die Bedeutung des Zeichens des neuaufblühenden Feigenbaumes noch weitgehend fehlt. Messianische Juden werden gar von Bischöfen und Theologen als Störenfriede für den jüdisch-christlichen Dialog empfunden und darum an Kirchentagen, wo man lieber Muslime einlädt, ferngehalten.
Die messianische Bewegung ist deshalb wichtig, weil sie das Bindeglied bildet zwischen uns „Heidenchristen“ und den Jeshua (noch) fernstehenden Juden. Sie zeigt auch, dass Gott dran ist, die Vollständigkeit und Einheit der Kirche in der richtigen Reihenfolge „wiederherzustellen“: nämlich die jüdischen Ersterwählen in der Mitte, und anschliessend wir, die wir „einst Fremde ohne Bürgerrecht“ waren, und nachträglich „Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes“ wurden (Eph 2,19). Oder mit dem andern Bild: wir als die nachträglich auf den edlen Ölbaum Israel aufgepfropften wilden Zweige (Röm 11,17. Darum: „Bedenke: nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich!“ (Röm 11,18).
Viele Juden ringen um ihre Identität und fragen sich, was sie zu Juden macht. Sie merken, dass es nicht nur die Abstammung von einer jüdischen Mutter sein kann, sondern dass etwas Besonderes sie durch alle Jahrhunderte von allen Völkern abgesondert und Verfolgungen ausgesetzt hat. Manche messianische Juden bezeugen, dass sie erst durch den jüdischen Messias Jeshua ihre volle jüdische Identität gefunden haben, als „Zeichen unter den Völkern“. Sie sehen, dass ihr von säkular Nichtglaubenden bis zu Ultraorthodoxen aufgesplittertes Volk dringend Jeshua braucht, um seine Identität und Einheit zu finden. [51]
Wir „Heidenchristen“ sind nicht berufen, den Juden ihren Messias zu predigen. Doch wir können die Juden durch unser christuserfülltes Leben auf ihn „eifersüchtig“ machen, wie Paulus andeutet (Röm 11,11). Wir Heidenchristen haben uns mit unserem Antisemitismus für „Judenmission“ als ungeeignet erwiesen. Exegetisch hat Klaus Berger herausgestellt, dass der Missionsauftrag Jesu („Macht alle Menschen zu meinen Jüngern!“) nicht im Sinn von heidenchristlicher Judenmission zu verstehen ist, sondern dass die zur Judenmission Berufenen ihre eigenen jüdischen Brüder sind, welche ihre Erfahrung mit Jeshua als dem König Israels ihren jüdischen Brüdern bezeugen. So Philippus zu Natanael: „Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben“ (Joh 1,45), und Jesus zu den Aposteln: „Geht nicht zu den Heiden…, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel“ (Mt 10,6).
Wenn wir also den Juden ihren Messias nahebringen wollen, sollen wir uns zuerst als echte „Freunde Israels“ erweisen, indem wir die Hindernisse, die wir durch den Antisemitismus gegen die Juden aufgebaut haben, abbauen und gegen den schwelenden Antisemitismus in Kirche und Welt auftreten. Wir sollen für sie überzeugende Zeugen Jesu sein, doch die direkte „Judenmission“ den jüdischen Glaubensbrüdern überlassen und sie dabei unterstützen.
18. Die Lehre aus der Nahostsynode
Das oben Gesagte bewegt uns, weiter zu überlegen, was den Kirchen noch fehlt, um Friedensstifter und Brückenbauer zu sein. Ich knüpfe dabei an bei der Bischofssynode, die vom 10.-24. Oktober 2010 im Vatikan mit 185 Bischöfen und weiteren Teilnehmern vor allem aus den Nahostländern tagte, die sich mit der schweren Situation der dortigen Kirchen und Christen befasste. [52]
Anlässlich dieser Synode verkündete der griechisch-katholische Erzbischof Cyrille Salim Bustros lauthals: „Die Heilige Schrift rechtfertigt nicht die Rückkehr der Juden nach Israel und die Verdrängung der Palästinenser und die Besatzung der palästinensischen Gebiete durch Israel […]. Wir Christen können vom ‚gelobten Land’ nicht als ausschliessliches Recht für ein privilegiertes jüdisches Volk sprechen. Diese Verheissung wurden von Christus aufgehoben […]. Es gibt fortan kein auserwähltes Volk mehr, - alle Männer und Frauen aller Länder sind das auserwählte Volk geworden […].“. [53]
Diese Erklärung erregte den Protest vieler Andersdenkender. Der Vatikansprecher Pater Lombardi SJ versuchte, diesen Protest aufzufangen, indem er erklärte, dies sei die persönliche Auffassung von Bustros und nicht die offizielle Botschaft der Synode, aber vermied es, dieser dem Konzil widersprechenden Irrlehre die klare biblische, im Konzil festgehaltene Lehre entgegenzustellen, nämlich dass die Juden immer noch Gottes geliebtes Volk sind mit unwiderruflichen besonderen Gnadengaben und Verheissungen (zu denen vorrangig die äussere und innere Wiederherstellung im Land der Väter gehört). Die Analyse der Schlussbotschaft der Synode „Nuntius. Botschaft an das Volk Gottes“ [54] zeigt, dass hier weitgehend das biblische Verständnis für die Sonderberufung der Juden und damit für die Hintergründe des Nahostgeschehens fehlt. Freilich lässt sich das verwirrte Nahostgeschehen nicht auf diesen Kernpunkt reduzieren, doch lässt es sich nur vom Sonderplan Gottes mit seinem Volk aus entwirren. Die Rede von der „Besetzung arabischer Gebiete durch die Israeli“ lässt vermuten, dass die Synodalen entweder mit dem Lager des „Kairos-Palästina-Dokumentes“ sympathisieren, oder einfach hilflos zu dieser brennenden Situation die Augen verschliessen und schweigen. Auch die Vatikanstellen scheinen lieber zu schweigen. Ein Experte für arabische Länder, P. Pierre-Marie Soubeyrand, benennt die Schlussbotschaft als „profillos; es ist kein prophetischer Text, sondern ein Kompromiss“, der lavierenden Haltung des Vatikan entsprechend. PJS fügt bei: „Auch Nostra aetate war ein Kompromiss, dessen prophetischer Inhalt erst allmählich verstanden wird;“ in den Synodaldokumenten würde der prophetische Ausblick nicht ganz fehlen. Aber eben: der Kernpunkt wird scheu umgangen, nämlich dass Gott heute, als Antwort auf den Holocaust, drangegangen ist, wie es Heinrich Spaemann ausdrückt (s.o. Kap.5), seine Verheissungen an Israel im Blick auf die „Wiederherstellung aller Dinge“ am Ende der Zeiten“ (Apg 3,21) an die Hand zu nehmen und damit die Christenheit zur Mitarbeit an der Seite der Ersterwählten aufruft. Dieser endzeitliche (eschatologische) Blick ist bei Traditionschristen im Gegensatz zu gewissen als „Fundamentalisten“ belächelten Freikirchen getrübt, worüber ich das folgende Unterkapitel einschiebe (18.1).
Eingeladen war von der Nahostsynode auch Rabbi David Rosen, der israelische Beauftragte für jüdisch-christliche Beziehungen, der mehrmals im Vatikan an Gesprächen mit Papst Johannes Paul II. teilgenommen hat. Er hob die positive Entwicklung in der katholischen Kirche und der jüdisch-christlichen Zusammenarbeit hervor. Der Heiliglandbesuch von Papst Johannes Paul II. im Jahr 2000 mit seinem Anliegen der „gegenseitigen Freundschaft und Achtung“ habe das Verhältnis der Israelis zur katholischen Kirche wesentlich verbessert. Er erwähnte, dass etwa 200 israelische Organisationen die arabisch-jüdischen Beziehungen fördern, Duzende von Organisationen das interreligiöse Gespräch zwischen Juden, Christen und Moslems fördern. Doch verschweigt er nicht die Schattenseite: dass viele palästinensische Christen unzufrieden sind mit ihrer Situation und dass ihre Äusserungen „nicht immer übereinstimmen mit dem Buchstaben und Geist des kirchlichen Lehramtes in Bezug auf die Beziehung zwischen Juden und Christen… Der starke Einfluss des arabisch-israelischen Konflikts sei bei vielen von ihnen stärker als die Entdeckung der jüdischen Wurzeln der Kirche, so dass bei ihnen oft die historischen Vorurteile überwiegen“ . Der Vorwurf arabischer Christen, die „israelische Besatzung“ sei „die Wurzel des Übels“, sei unaufrichtig, denn die wahre Wurzel des Konfliktes sei „die Unmöglichkeit der arabischen Welt, eine nichtarabische Souveränität in ihrer Mitte zu dulden.“ Die Haltung vieler arabischer Christen stehe in schroffem Gegensatz zu den Äusserungen von Papst Johannes Paul II. Bei einer anderen Gelegenheit erklärte Rabbi David Rosen: „Ich bin einigen Priestern und Bischöfen begegnet, die die Erklärung des II. Vatikanischen Konzils über die Juden nicht kannten“. [55]
An den von Rabbi Rosen gerühmten Organisationen, die sich für die Annäherung von Juden und Palästinensern einsetzen, seien die Christen aus den traditionellen einheimischen (katholischen und orthodoxen) Kirchen kaum beteiligt im Unterschied zu evangelikalen Gruppen und zu motivierten, von aussen eingewanderten Katholiken (z.B. Ordensleute). Angesichts der Unfähigkeit der einheimischen Kirche, „die Verantwortung als Friedensstifter allein zu tragen“, sei zu hoffen, „dass sie motiviert und unterstützt werde von der Weltkirche und ihrer Zentralleitung.“
Damit trifft Rabbi Rosen den wunden Punkt der traditionellen palästinensischen Kirche. Er appelliert an die Weltkirche, ihre arabischen Glaubensgeschwister anzuweisen und zu ermutigen, ihre Rolle als „Peacemaker in der Stadt Jerusalem, deren Name Frieden bedeutet und die eine grosse Bedeutung für unsere Gemeinschaften hat, auszuüben.“
Der Vorstoss zur Zweistaatenlösung zeigt, dass die Verantwortlichen der Weltkirche ihre Verantwortung als „Peacemaker in der Stadt des Friedens“ noch nicht klar sehen, denn die Betreiber des palästinensische Staates haben den Anspruch auf Jerusalem im Sinn des Islam nicht aufgegeben.
18.1. Pfingstliches Endzeitfieber als ökumenischer Stachel – die verkannte Eschatologie
In der Pfingstbewegung und in charismatischen Strömungen ist die Erwartung der nahen Wiederkunft Christi die treibende Kraft, verstanden als Frucht der Geistausgiessung. Darauf geht Peter Hocken in seinem Buch „Herausforderungen der pfingstlichen, charismatischen und messianisch-jüdischen Bewegungen“ [56] ausführlich ein. Hocken ist der führende katholische Theologe der „Strategie des Heiligen Geistes“ [57] im Zusammenspiel der Erweckungsbewegungen im Rahmen der gesamten Ökumene. Er schreibt:„Die erste Generation der Pfingstler war von der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft des Herrn überzeugt“ (a.a.O. S. 117).„In den Erweckungsbewegungen steht die Eschatologie an erster Stelle“ (S. 126). Die Begegnung mit Israel und der messianischen Bewegung„konfrontiert die Kirche mit ihrer eigenen Identität und verbindet sie mit der messianischen Hoffnung“, wie Paulus von den Israeliten bezeugt: „Ihnen gehören… die Verheissungen“ (Röm 9,4; S. 126). Auch der Katholische Katechismus lehrt: „Blickt man auf die Zukunft, so streben das Gottesvolk des Alten Bundes und das neue Volk Gottes ähnlichen Zielen zu: Die Ankunft (oder Wiederkunft) des Messias…“ (Nr. 840). Was Christen und Juden noch stärker miteinander verbinden könnte und müsste, ist die eschatologische Hoffnung, die in den alten Kirchen im Unterschied zu Erweckungsbewegungen weitgehend verkümmert ist. Hocken fährt weiter: „Die Erneuerung der messianischen Hoffnung in der Kirche hängt ab von der Erneuerung ihrer rechten Beziehung zum jüdischen Volk. Das bedeutet die rechte Beziehung zum israelitisch/jüdischen Volk in all seinen Phasen, seinen Schriften und seinem Erbe. Die Erneuerung der rechten Beziehung erfordert das Bekenntnis aller Sünden und Verirrungen in der vergangenen Geschichte der Beziehung zwischen Kirche und Synagoge… Es erfordert die volle Wiederaufnahme der messianischen Erwartung in der biblischen Tradition. Im Mass diese Reue und Reinigung der Erinnerung in uns Platz nimmt, wird die messianische Hoffnung in uns wieder aufleben.“ Die Reue und das Sündenbekenntnis der Christen ist notwendig, „um das jüdische Volk dazu freizusetzen, seine Berufung, ein Segen und ein Licht für die Völker zu sein, wieder als ihm zugesprochen wahrzunehmen.“ Dabei spielen die messianischen Juden eine besonders wichtige Rolle „als der am meisten prophetische und dynamische Teil der Wiederherstellung der jüdischen Komponente der Kirche… Indem die Kirche sich in der Welt etablierte, verlor sie nicht nur ihre eschatologische Orientierung und überliess diese den Randgruppen, sondern bewahrte die verfolgten Juden vor einer ähnlichen Assimilierung an die Welt. Die erneuerte christliche Beziehung zu den Juden verlangt, dass wir den nicht dem Weltgeist assimilierten Charakter des jüdischen Lebens durch Jahrhunderte in der Diaspora ehren und wertschätzen“ (a.a.O. S. 127).
19. Appell an die Kirchenverantwortlichen nicht nur im Vatikan
Im Vatikan wirken vorbildliche Kräfte. Ich kenne und schätze persönlich Kardinal Kurt Koch, den Vorsitzenden des päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, ein hervorragender Israeltheologe. In einem Interview mit dem Hilfswerk „Kirche in Not“ bezeugte er, dass die Landverheissung zum jüdischen Glauben gehört, was von uns Christen zu respektieren sei. Doch die praktischen Konsequenzen daraus für den Nahostkonflikt wagt er nicht zu ziehen und wiederholt einfach die Formel der Zweistaatenlösung. Er ermutigte mich in einem Brief zu meinem Einsatz, aber bemerkte, dass er sich für dieses weite Feld nicht kompetent wisse. Er hat genug zu tun mit der Ökumene unter den Konfessionen im Blick auf das Reformationsgedächtnis 2017 und mit der Ökumene mit den orthodoxen Kirchen, und er tut dies wahrhaftig gut.
Da ist auch Kardinal Christoph Schönborn von Wien, Primas von Österreich. Ich kenne ihn persönlich und schätze ihn. Er schenkte mir mit persönlicher Widmung sein Buch „Die Menschen, die Kirche, das Land“ [58] , in dem er schreibt (S. 204):
„Die Heimkehr nach Eretz Israël ist ein Zeichen der Hoffnung, noch nicht die Erfüllung der Hoffnung. Noch sind wir Pilger, und das ist uns allen gemeinsam, die wir versuchen, Kinder Abrahams zu sein, der selber sich als „Pilger und Beisassen“ verstand. Noch sind die Kinder Israels versprengt, auch wenn die Sammlung begonnen hat. Noch herrschen beschämende Spaltungen – welches Bild der Uneinheit geben die Christen im Heiligen Land, aber auch die Juden und die Muslime! – und doch erbitten wir alle von Gott, und das ist uns gemeinsam: „Erbittet Frieden für Jerusalem. Wer dich liebt, sei in dir geborgen! (Ps 122,6).“
Kardinal Schönborn bekennt sich zu seinen jüdischen Wurzeln und setzt sich ein für die messianische Bewegung, insbesondere für die Bewegung TJC-II, auch als deren Verbindungsmann zum Vatikan. Er schreibt in einem persönlichen Brief an Fürst Albrecht zu Castell-Castell, ebenfall ein Förderer der TJC-II:
„Verehrter Freund […], dass unser Glaube ohne den Wurzelstamm Israel nicht zu denken ist, das war Dir seit langem bewusst, und auch ich habe von Kind an, besonders von unserer Mutter, die Liebe zum Judentum mitbekommen […]. Der Herr will, dass wir die Liebe zu seinem Volk bezeugen und auch aktiv weitergeben.“
Dieser Brief wurde als Vorwort (neben dem Vorwort seines lutherischen Kollegen, des Altbischofs Ulrich Wilckens) abgedruckt in dem vom Fürsten Albrecht initiierten Sammelwerk: „Geistgewirkt – Geistbewegt. Die charismatische und die messianische Bewegung“. [59] Dieses Buch zeigt, wie die messianische Bewegung die christlichen Konfessionen drängt, näher zusammenzurücken. In seinem Beitrag darin drückt der Fürst sein Verlangen nach der Einheit rund um den Abendmahlstisch aus: „Auf dem Weg zur Einheit sind noch viele Schritte erforderlich […]. Das Bild meiner Hoffnung ist ein Tisch im Abendmahlssaal in Jerusalem, an dem sich Vertreter von Gemeinden und Bewegungen aus dem jüdischen Volk und von Kirchen und Gemeinschaften aus den Heidenvölkern versammeln“ (S. 257).
Notwendigkeit eines konziliären Prozesses. Das Vorausgehende zeigt, dass die zu bereinigenden Differenzen so gross sind, dass sie nicht von einem Einzelnen autoritativ bereinigt werden können, sondern dass es einen konziliären Prozess braucht nach dem Modell des Apostelkonzils von Apg 15, mit Mitwirkenden über die katholische Kirche hinaus, mit Juden und dialogoffenen Muslimen, wie schon beim letzten Konzil. Zur Themenliste würde u.a. gehören:
- Was sagt die Bibel zum Nahostkonflikt und zur „Wiederherstellung“ des jüdischen Volkes? Welche Stellung hat der jüdische Staat im Rahmen der biblischen Prophetie?[60]
- Überwindung der „Enterbungslehre“ in der Auseinandersetzung mit den arabischen Theologen.
- Was steckt hinter dem Islam und wie sollen wir ihm als Christen begegnen?
- Wie integrieren die Kirchen die messianische Bewegung? Neue Aspekte der Ekklesiologie. – Zur Rolle des Hl. Geistes.
Das Anliegen eines solchen Konzils ist unter dem Wehen des Heiligen Geistes ein gewaltiges Umdenken, eine „Bekehrung zum Israel Gottes“ (Cantalamessa), eine Vision, für welche auch Frieden und Versöhnung suchende Juden (Israelis) und Muslime offen sind. Besonders die vom Nahostkonflikt betroffenen Bischöfe und Theologen brauchen diese biblische Vision, um Brückenbauer zu werden, zusammen mit jenen, die dies jetzt schon tun im Geist der „Amici Israel“ (s.u.) oder „christlichen Zionisten“.
Papst Franziskus , der bekannt ist für seine Freundschaft mit Rabbinern und Muslimen, musste merken, dass es nicht genügt allen zu sagen: ihr habt eine gute Religion. Ich könnte ihm zutrauen, dass er den Mut hat, wie einst Papst Johannes XXIII, einen konziliären Prozess anzustossen, wo die Meinungen aufeinanderprallen und unter dem Wehen des Hl. Geistes abgeklärt werden, wie er schon den Mut hatte, eine brodelnde Bischofssynode über die Familie einzuberufen, wo Kardinäle gegen Kardinäle Stellung nehmen. Die Bischöfe mögen die politischen Konsequenzen aus der „Judenerklärung“ von Nostra aetate ernst nehmen und sich den von mir aufgeworfenen Fragen stellen.
20. Der Ruf nach einer neuen Bewegung von „Freunden Israels“ („Amici Israel“)
Viele christliche Organisationen, vor allem evangelische bis hinauf zum ÖRK [61], stellen sich gegen Israel und beeinflussen mit den Medien die Volksmeinung, z.B. mit Boykottaufrufen, und verbinden sich, biblisch gesehen, mit den Völkern, die gemeinsam gegen Jerusalem losstürmen (z.B. Ps 2; Sach 12,2; 14,2). Weltweit wächst der Antisemitismus. Das weckte vor allem evangelische Kreise, Gegenfront zu machen durch Werke, die sich im christlichen Geist für Israel und die Juden einsetzen. Doch auf katholischer Seite ist dies in diesem Ausmass noch nicht gelungen.
Das zieht unsere Aufmerksamkeit auf die katholische Vereinigung „Amici Israel“ (Freunde Israels), die 1924 in Rom gegründet wurde, genauer als „Opus sacerdotale Amici Israel“ (Priesterliche Vereinigung der Freunde Israels), der etwa 3000 Ordensangehörige und Priester, 328 (Erz-) Bischöfe und 19 Kardinäle angehörten, unter ihnen der Münchner Kardinal Michael von Faulhaber. Mitinitiantin und Inspiratorin war die aus einer berühmten jüdischen Familie in Holland stammende, zum katholischen Glauben konvertierte Sophie Franziska von Leer (1892-1953), die mit Kardinal Faulhaber in engem Kontakt stand.
Darüber berichtet das Buch von Andreas Renz: „Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog. 50 Jahre „Nostra aetate“ - Vorgeschichte, Kommentar, Rezeption“[62]: „ Diese neue Bewegung war nicht nur eine Bekehrungsoffensive oder Gebetsvereinigung, sondern stellte zugleich eine Initiative dar, die den katholischen Antisemitismus bekämpfen, die Liturgie verändern und eine reale Unterstützung für die Juden und das Judentum – und sogar für den Zionismus – erreichen wollte“ (Renz S. 59).
Wikipedia führt weiter aus: „Ziel der Vereinigung war die Förderung der Versöhnung von Juden und Christen und dabei insbesondere der Katholiken. In einer Zeit, als der Antisemitismus in ganz Europa zu einem ernsten Problem wurde, war es die Absicht dieser hohen Würdenträger, Priester und Ordensleute, die Freundschaft mit dem Volk des Alten Bundes zu betonen. Christen sollten verstehen lernen, dass das Alte und das Neue Testament zusammengehören und die jüdische Wurzel des Christentums nicht vernachlässigt werden darf.“
Doch – Zeichen der Blindheit in der Kirchenführung - der Sekretär des Heiligen Offiziums, Merry del Val, der zwar den Nationalsozialismus verwarf, „sah in den Amici Israel in antisemitischer Manier eine jüdische Verschwörung und forderte vom Papst die Auflösung der Vereinigung“ (Renz S. 60). So löste Papst Pius XI. 1928 diese Vereinigung auf ohne Angabe der Hintergründe. Nach Öffnung der Vatikanischen Archive 2003 wurden weitere Details bekannt. „In geheimen Beratungen formulierten del Val und Pius XI. ein am 14. März 1928 veröffentlichtes Dekret, das den Rasse-Antisemitismus als unchristlich verurteilte, aber zugleich von einem christlichen Antijudaismus unterschied, um diesen zu legitimieren. Die Gruppe Amici Israel wurde verboten und ihre Leiter durch Vorladungen und Verhöre genötigt, ihre Anschauungen vollständig zu widerrufen“ (Wikipedia). Im Klartext: „Wir können die Juden als Gottesvolk nicht annehmen, weil sie Jesus verworfen haben“, wie es schon Pius X. beim Besuch von zionistischen Führern ausdrückte.
Heute wäre es in der katholischen Kirche höchste Zeit, dass wiederum eine Bewegung von „Freunden Israels“ entstünde mit Vertretern aus der Hierarchie als Gegenfront gegen die noch der „Enterbungstheologie“ Verhafteten. Wir bräuchten dazu eine charismatische Gestalt wie damals die jüdische Konvertitin Sophie Franziska von Leer, die den Funken auslösen könnte.
Diese Bewegung müsste sich freilich vernetzen mit den vielen ähnlich ausgerichteten nichtkatholischen, „christlich-zionistischen“ Bewegungen, was für die Strategie Gottes im Kampf für den „Frieden von Jerusalem“ ein grosses Plus wäre.
21. Unmöglichkeit der Zweistaatenlösung
Aus dem Vorausgehenden wurde deutlich, dass die einseitige Zweistaatenlösung ein utopisches Luftschloss ist. Die Vatikandiplomaten können nicht erklären, wie dies praktisch aufgrund der faktischen Umstände auszuführen wäre.
Die Lösung beginnt nicht mit Verhandlungen mit den palästinensischen Führern, sondern mit dem Umdenken im eigenen christlichen Lager im Sinn des dargestellten biblischen Friedensplans Gottes. Im Folgenden einige Gründe für die Unmöglichkeit.
Ein Staat braucht feste Grenzen. Schon hier beginnt die Schwierigkeit. Gemäss Resolution 242 des Sicherheitsrats von 1967 (gültig ist die englische Version) sind sichere und anerkannte Grenzen festzulegen (auf die sich Israel dann zurückziehen würde). Die Resolution verlangt keinen Rückzug Israels aus allen 1967 besetzten Gebieten. Die PA drängt jedoch mit weltweiter politischer Unterstützung auf eine Rückkehr Israels zu den (rechtlich nicht existierenden) „Grenzen von 1967“, - die der Waffenstillstandslinie von 1949 entsprechen. Diese trennte von 1948-67 Judäa/Samaria (sog. Westjordanland) und Ostjerusalem von Israel. Im Waffenstillstandsvertrag mit Jordanien von 1949 steht, dass jene Linie (green line genannt) zukünftige Grenzen nicht präjudizieren darf. Gewiss hatten die Palästinenser gemäss dem Völkerbundmandat, das eine Einstaatenlösung vorsah, genau so wie die Juden das Recht, dort zu wohnen, doch schuf der arabische Angriffskrieg von 1948 eine neue Situation. Mit einem Palästinenserstaat würden die Juden dort aus ihrem Stammgebiet ausgeschlossen. Und sollte sich der sogenannte internationale Konsens für einen Palästinenserstaat in den „Grenzen von 1967“ durchsetzen: Diese Staatsgrenze wäre kein sichere Grenze, weil nicht zu verteidigen. Überhaupt ist es dumm zu behaupten, die Juden hätten palästinensisches Land okkupiert (es hat nie einen solchen Staat gegeben). Beide Völker hatten ursprünglich gemäss Balfour-Erklärung das Recht, dort zu wohnen, doch anerkannten die Araber die jüdische Einwanderung nicht. Mindestens hätten ja all diejenigen arabischen Palästinenser bleiben können, die nur auf die Aufrufe ihrer Führer hin ihre Häuser verliessen. Viele Araber waren auch geblieben.
Eine weitere Knacknuss ist der Status von Jerusalem. Gemäss Dr. Jacques Gauthier, Toronto, gehört ganz Jerusalem nach internationalem Recht zu Israel (Universität Genf 2007). Doch die Palästinenser fordern als ihre Hauptstadt Ostjerusalem mit der Altstadt, dem eigentlichen Jerusalem mit der heiligsten Stätte der Juden und dem jüdischen Viertel (1948-67 von Jordanien besetzt). Jerusalem war nie palästinensische Hauptstadt oder die eines anderen Staates. Freilich waren die Israelis immer bereit, friedlich mit den Arabern in Jerusalem zu wohnen. Sie haben sogar den Tempelplatz den muslimischen Behörden, dem Waqf, zur Verwaltung übergeben, die ihnen verbietet, dort, am Platz ihres einstigen Hauptheiligtums zu beten, und die sich bemüht, archäologische Beweisstücke der früheren jüdischen Präsenz zu zerstören. Bis 1967 haben die Pilger noch den Gräuel der geteilten heiligen Stadt erlebt, wo die Jordanier 58 Synagogen und tausende Gräber auf dem Ölberg zertörten, um mit dem Material Bauten, Strassen und Latrinen zu bauen. Die UN-Resolution 478 von 1980 erklärte zwar die Annexion von Ost-Jerusalem im Sechstagekrieg für nichtig, während sie in Wirklichkeit eine legale Rückeroberung war. (Zu erinnern ist, dass die Rechte der Juden aus dem Völkerbundsmandat durch Art. 80. der UNO geschützt sind.) Wir begreifen, dass im selben Jahr die Knesset „ganz Jerusalem“ (mitsamt Ostjerusalem) zur „ewigen und unteilbaren Hauptstadt“ Israels erklärte. Dadurch hat Jerusalem an baulichem Glanz gewaltig gewonnen. Wie gesagt würde das nicht hindern, dass auch die Palästinenser eine gebührende Präsenz in der Stadt bekunden können, was ihnen schon z.T. mit der Überlassung des Tempelplatzes gewährt ist, doch ist die Forderung eine deutliche Spitze gegen Jerusalem als jüdische Hauptstadt. Beides geht wirklich nicht zusammen: Jerusalem als jüdische, für alle Völker gastfreundliche Hauptstadt und zugleich als israelfeindliche palästinensische Hauptstadt! Die Israelis waren auch nicht gegen eine gewisse internationale Kontrolle, vorausgesetzt, der jüdische Charakter wäre nicht gefährdet.
Vielfach wird behauptet, Israel verhindere die Zweistaatenlösung durch den wachsenden „Siedlungsbau“ im sog. Westjordanland. Nach dem Law of War gilt das Gebiet solange als „besetzt“, bis die territorialen Fragen gelöst sind. Politisch gilt es als „umstrittenes“ Gebiet, das also nicht einfach den Palästinensern gehört. Warum sollten die Juden dort nicht bauen (ausser es handelt sich nachweislich um palästinensisches Privatland), die Palästinenser bauen ja auch. In Oslo waren die Siedlungen kein Thema. Abgesehen davon sind manche Palästinenser dankbar für die „Siedlungen“, in denen sie gut verdienen können, d.h. Boykottaufrufe schaden auch diesen Arbeitern. Wenn wir die Landkarte anschauen und das kleine Israel (20'000 km2) mit den umgebenden islamischen Ländern (ca. 640mal grösser), wird es klar, dass Israel nicht noch mehr Land weggeben kann, sondern, dass Israel durch Landweggabe statt Frieden nur noch mehr Bedrohung einhandelt, wie der Gaza-Rückzug gezeigt hat.
Schon hier beginnt die Schwierigkeit. Die PA drängt auf die Rückkehr zu den „Grenzen von 1967“, einem Zusstand von 1948-1967, als Jordanien Judäa/Samaria (die sog. „Westbank“) und Ostjerusalem (alles Teile des britischen Mandatsgebietes) besetzt hielt. Gewiss hatten die Palästinenser genau so wie die Juden das Recht, dort zu wohnen. Auch wenn es den Zionisten gelungen wäre gemäss dem Völkerbundsbeschluss, dieses Gebiet als ihre „Heimstätte“ zu beziehen, hätten die Palästinenser dort gemäss dem Angebot der Staatsgründungsurkunde weiter frei leben können. Doch mit einem Palästinenserstaat wären die Juden dort aus ihrem Stammgebiet ausgeschlossen. Zudem sind die Grenzen von 1967 keine Staatsgrenzen, sondern unbereinigte Waffenstillstandslinien. Bei einem Rückzug auf diese Linie wäre Israel nicht mehr zu verteidigen.
Dass dieses Gebiet Israel zufiel, ist den arabischen Staaten zu verdanken als Folge ihres verlorenen Angriffskrieges. Das Beispiel Deutschland zeigt, wie man durch widerrechtliche Eroberungskriege Gebiete verlieren kann. So verloren die Jordanier die Westbank an Israel infolge des Einfalls 1967 im Sechstagekrieg. Freilich gilt: beide Völker haben das Recht in diesem Gebiet zu wohnen, was von israelischer Seite aus im Frieden hätte geschehen können, während Mahmoud Abbas in Kairo wünschte, den Palästinenserstaat „judenrein“ zu haben (s.o. Kap.9). Die Schuld für das Nichtgelingen liegt freilich nicht einseitig bei den Palästinensern (so PJS).
Vielfach wird behauptet, Israel verhindere die Zweistaatenlösung durch den wachsenden „Siedlungsbau“ im Palästinensergebiet. Doch sollte nun klar sein, dass dieses Gebiet staatsrechtlich nicht „besetztes“, sondern „umstrittenes“ Gebiet ist, also nicht einfach den Palästinensern gehört. Warum sollten die Juden dort nicht bauen, nachdem schon der grössere Teil des ehemaligen Mandatgebietes Palästinenserland ist, nämlich Jordanien, in dem die Palästinenser die Mehrheit bilden. Abgesehen davon, dass manche Palästinenser dankbar sind für die „Siedlungen“, in denen sie gut verdienen können, und dass die Boykottaufrufe auch ihnen schaden. Wenn wir die Landkarte anschauen und das kleine Israel (20'000 km2) mit den umgebenden islamischen Ländern (ca. 640mal grösser), wird es klar, dass Israel nicht noch mehr Land weggeben kann, sondern, dass Israel durch Landweggabe statt Frieden nur noch mehr Bedrohung einhandelt, wie der Gaza-Rückzug gezeigt hat. [63] Übrigens wäre das Westjordanland schon 1948 Palästinensergebiet, wenn dessen Führer den UN-Teilungsplan angenommen hätten.
Johannes Gerloff (s.o. Kap. 13) ist im Gespräch mit anerkannten Experten für internationales Recht wie dem Briten Alan Baker der komplizierten Rechtslage der Siedlungen nachgegangen und kommt zum Schluss: die Siedlungen, die auf Staatsland gebaut wurden, sind juristisch in Ordnung, doch nicht unbedingt politisch korrekt und praktikabel. Hingegen die Siedlungen, die auf Privatland gebaut sind, müssten als widerrechtlich geräumt werden. [64]
Doch auch wenn die rechtlichen Fragen eindeutig abgeklärt werden könnten, der Friede liegt auf einer höheren Ebene. Zu einer friedlichen Lösung braucht es eine Bekehrung von beiden Seiten in Richtung der biblischen Vision eines zwar jüdisch geprägten, den Juden zur Verwaltung anvertrauten Staatswesens, das aber nicht nationalistisch auf die Juden fixiert ist, sondern für alle Völker offen ist, die sich unter den „Gott Jakobs und seines Gesalbten“ beugen. Viele Juden sind offen für diese Vision (wie es z.B. Martin Buber mit seinem Kulturzionismus war).
Doch wächst unter dem Druck der arabischen und internationalen Bedrohung eine Verteifung der Israelis auf den jüdisch-nationalistischen Charakter des Staates im Geist des nationalistisch-revisionistischen Zionismus von Wladimir Jabotinsky (+1940), von dem auch Netanjahu beeinflusst ist. Die Revisionisten waren jene, welche zur Aufrechterhaltung des jüdischen Charakters des Staates mit einem „Transfer“ der Palästinenser liebäugelten. Gegen diese gefährliche nationalistische Abgrenzung der Juden bräuchte es eine genügende Zahl Israel liebender Christen, welche Israel zu dieser Öffnung verhelfen und die Brücke zu den Muslimen bilden, also „christliche Zionisten“ im Geist der biblischen Prophetie (s.o. Kap. 6).
Der Konflikt liegt in der Linie der biblischen Prophetie, dass sich am Ende der Zeit alle Völker gegen Jerusalem erheben werden und dass dieses zum „Taumelbecher“ und „Laststein“ wird, an dem die Völker zu Fall kommen (Sach 12,2-5).
Ich schliesse mich der Sicht von Hanspeter Büchi an: „ Angesichts der mehrmals angesprochenen, im Islam begründeten, fundamentalen Feindseligkeit gegenüber Israel wird es keine politische Lösung geben. Denn das Ziel der Moslems ist nicht Frieden, sondern die Vernichtung Israels. Erstaunlicherweise macht niemand daraus ein Geheimnis – und doch stört es offenbar die sonst so sehr auf Frieden und Gerechtigkeit ausgerichtete Welt nicht. Es ist wie gesagt ein geistlicher Kampf und wenn man sich in diesem Kampf bewegt, so ergeben sich immer wieder Situationen, in denen die Blindheit und Taubheit gewisser Israelkritiker fast mit Händen zu greifen ist. Dies schmerzt besonders dann, wenn uns Kirchenleute gegenübersitzen. Gott wird die Weltgeschichte mit Israel zu Ende schreiben und mangels einer „weltlichen“ Lösung wird es weiterhin darum gehen, diesen blutigen und nervenaufreibenden Konflikt zu „managen“. Es wird immer schwieriger werden (siehe die biblische Prophetie), doch vertrauen wir auf Gott, der alles unter Kontrolle hat. Wichtig ist das Einstehen der Christen im Gebet und im Alltag für Israel. Gerade letzteres fordert etwas Zivilcourage, setzt aber voraus, dass wir wichtige Fakten kennen.“
Dem füge ich hinzu: Ein Hoffnungszeichen ist, dass immer mehr Muslime und Juden betroffen werden von der heutigen Entfesselung dämonischer Mächte, die rein politische Lösungen unmöglich machen und dadurch sich öffnen für die Friedensbotschaft Jesu (siehe Kap. 15 und 17). Doch leider sind ein Hindernis dafür die vielen Christen, welche durch ihr Leben die Botschaft Jesu verdunkeln und denen der biblische Blick auf die Berufung der Juden und die Widersacherrolle des Islams fehlt, was sich im unversöhnten Widerstreit der beiden Lager zeigt (siehe Kap.2). An den Kirchenleitungen liegt es, in einem konziliären Prozess die Kluft zu überwinden durch Zuwendung zum biblischen Friedensplan gemäss den folgenden biblischen Leitbildern.
22. Biblische Leitbilder zum Abschluss
Die Bibel redet nicht nur mit Worten (Buchstaben), sondern noch intensiver mit (Leit-)Bildern:
1. Die Völkerwallfahrt auf den Berg Zion. Auf dieses Bild sind wir bereits eingegangen (s.o. Kap. 14). Es zieht sich durch die ganze Bibel, von Jes 2,1-5 bis zur Vollendung im himmlischen Jerusalem (Offb 21f). In der Mitte des Weges steht das Jerusalem zur Zeit, wo Jesus sein Heilswerk vollendete: als Kind im Tempel dargebracht als Opfergabe für den Frieden, als „König der Juden“ am Kreuz erhöht, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, von wo aus er im selben Jerusalem seinen Geist ausgoss, der durch alle Zeiten durch seine Jünger die Völker sammelt und zur Pilgerreise ins himmlische Jerusalem ausrüstet. Freilich sind die Völker als ganze noch nicht so kriegsmüde geworden, dass sie sich aufmachen „zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs“, „der auf Zion thront“, und seines Friedensfürsten Jesus. Doch wächst die Aufbruchbewegung unter Juden, Christen und Muslimen zu Jesus hin, der sie miteinander verbindet und zu Wegbereitern des Friedens macht.
Die Aktualität der Vision der Völkerwallfahrt konnte man in aller Welt am Fernsehen spüren, als am ersten Friedensgebetstreffen der Religionen 1986 in Assisi unter Papst Johannes Paul II. der Oberrabbiner von Rom feierlich die Botschaft von Jes 2,1-5 verlas. Auch Muslime machten mit, doch getrennt im Gebet, um Synkretismus zu vermeiden, ähnlich wie beim Friedensgebet in den vatikanischen Gärten unter Papst Franziskus am Pfingstmontag 2014. An diese Vision fügen sich weitere Leitbilder:
2. Der Aufblick auf den Durchbohrten. In der grössten Bedrohung Jerusalems durch die anstürmenden Völker kommt die Rettung durch den Aufblick auf den Durchbohrten:„Sie werden aufblicken zu mir (bzw. zu dem, EU), den sie durchbohrten“ (Sach 12,10). [65] Der Durchbohrte ist der für das Volk sühnend sterbende Leidensknecht von Jes 53,5 (und Ps 22,17), Jesus (Joh 19,34.37). Aus seinem durchbohrten Herzen lässt Gott „den Geist der Gnade (des Mitleids EÜ) und des Flehens“ ausgiessen und eröffnet „eine Quelle gegen Sünde und Unreinheit“ (Sach 13,1). In Offb 1,7; Joh 19,37 werden alle Völker eingeladen zum rettenden Aufblick auf den Durchbohrten.
In diesem Aufblick beginnt sich die „biblische Alternative zur Zweistaatenlösung“ zu verwirklichen: Dort, wo sich Juden, Christen und Muslime erfassen lassen „vom Geist des Mitleids“ zu einander, wo Christen trauern über das, was Juden unter ihnen erlitten haben, wo sich beide beim gemeinsamen Pilgern nach Auschwitz die Hände reichen, wo ehemalige Todfeinde sich im Namen Jesu umarmen (wie Taysir und Moran, s.o. Kap. 15), wo arabische Christen Juden um Vergebung bitten für ihr Unverständnis für deren Sonderberufung und wo Juden und Palästinenser um Verzeihung für gegenseitig angetanes Unrecht bitten, wo Juden von ihrem Messias berührt werden und sich mit Israel liebenden Christen verbinden, um sich gegenseitig in ihrer biblischen Berufung „gegen den Ansturm der Völker“ (vgl. Ps 2,1f; Offb 19,19) zu bestärken usw. Dies alles beginnt sich unter unseren Augen zu verwirklichen. „Erkennt ihr es nicht?“ (Jes 43,19). Wenn wir als Christen in genügender Zahl auf den am Kreuz erhöhten „König der Juden“ aufblicken und uns aus dem Segensstrom aus seiner Seite versöhnen lassen, werden auch wir „zu einer Quelle, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt“ (Joh 4,14), und zu Boten des Friedens.
Wie sich „der Geist des Mitleids und des Flehens“ auf das Mittragen auf dem Leidensweg des jüdischen Volkes auswirkt, zeigt das Buch der jesusgläubigen, israelischen Jüdin Julia Blum in ihrem Buch: „Bist du Gottes Sohn, so steig vom Kreuz herab“. [66] In Israel erlebte und erlebt sie hautnah die existenzielle Bedrohung ihres Volkes mit Terroranschlägen und Vernichtungsdrohungen. Die letzte Antwort fand sie bei Jesus, der am Kreuz die Verlassenheit von Gott hinausschrie und verspottet wurde mit dem höhnischen Zuruf: „Bist du Gottes Sohn, so steig vom Kreuz herab!“. Weitere Antworten gingen ihr auf beim Betrachten biblischer Szenen mit Abraham, der seinen einzigen Sohn opfern musste, mit Hiob und mit Jesus, der seinen Freund Lazarus zuerst dahinsiechen und sterben lassen musste. Die Autorin erlebt mit, wie die Welt dem verwundeten Israel dieselben Wunden schlägt, wie damals Jesus. Im Unbegreiflichen erkennt sie das Geheimnis der paradoxen Liebe Gottes, der seinen Sohn aus Liebe hingibt: „Nur die Liebe Gottes ist fähig, den auf den Altar zu legen, den sie liebt (um ihn zu opfern, wie es Abraham tat) . … Nach der Kreuzigung folgt die Auferstehung. Dieses grosse Wunder, zusammen mit der Freude und Herrlichkeit Gottes, erwartet den, den er selbst dazu bestimmt hat, durch Leiden und Tod zu gehen. ‚Denn wenn schon ihre Verwerfung für die Welt Versöhnung gebracht hat, dann wird ihre Annahme nichts anderes sein als Leben aus dem Tod’ (Röm 11,15)“ (a.a.O. S. 182f).
Dass auch säkulare Juden dieses Mitfühlen mit dem Leidensweg der Palästinenser, haben können, zeigt das oben (Kap. 6.1.) besprochene Buch von Ari Shavit.
3. Mit „Maria, der Mutter Jesu“ im „Obergemach“ versammelt. „Dort verharrten sie (die Apostel) einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen, mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern“ (Apg 1,13f). An Pfingsten öffnete der Heilige Geist den Weg der Heilsbotschaft zu allen Völkern. Durch die vom Heiligen Geist erfüllten jesusgläubigen Juden aus allen Ländern wird Israel zum „Licht der Völker“. Lukas hebt besonders die Rolle von „Maria, der Mutter Jesu“ hervor. Sie hat die Aufgabe, als verbindende Mutter die Juden und die Völker miteinander bei Jesus zu versammeln. In der lukanischen Theologie gibt Maria, als „Korporativperson“, d.h. als personifizierte „Tochter Zion“ im Namen ihres Volkes das bräutliche Ja zum Kommen des himmlischen Bräutigams, der sich durch sie mit seinem Volk vermählt. Als seine bräutliche Mutter, die seinen Erlöserweg bis unters Kreuz mittrug, setzte er sie ein als „Mutter aller Glaubenden“, welche als „Brautgemeinde“ teilnehmen am himmlischen Hochzeitsfest. [67]
Im selben „Obergemach“ hat Jesus vor seinem Sterben sich selber zum Abschied beim Pessachmahl als „Brot des Lebens“ seiner Ekklesia zur Stärkung auf der Pilgerreise übergeben. „Sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt“ (1 Kor 11,26).
Auch dieses Leitbild vom „Obergemach“ steht im Bezug zur „Wiederherstellung Israels“, ja zur „Wiederherstellung aller Dinge“ (Apg 3,21). Jesus möchte durch seinen Geist alle Völker rund um sein Volk der Ersterwählten sammeln und sie leibhaft in seine eucharistische Gestalt „einverleiben“.„Er hat durch sein Leben und Sterben die Wand der Feindschaft niedergerissen..., um die beiden (Juden und Heiden) in seiner Person zu einem einzigen, neuen Menschen zu erschaffen“ (Eph 2,14f).
Zur Lösung des Nahostkonfliktes braucht es gewiss die kleinen Schritte des politisch Machbaren. Doch dies bleibt bloss „Krisenmanagement“, wenn wir nicht dem Leitbild des „Obergemachs“ folgen, was tatsächlich schon da und dort geschieht: wo Christen aller Lager sich zum Gebet für Israel und um Ausgiessung des Pfingstgeistes versammeln und sich ausstrecken nach der Einheit am einen Tisch des Herrn (wie Fürst Albrecht zu Castell, s.o. Kap. 19). Bei Juden, Christen und Muslimen gibt es Zeichen, dass Maria am Werk ist.
Im Libanon hat der muslimische Ministerpräsident Saad al-Hariri 2010 das Fest der Verkündigung des Herrn an Maria vom 25. März per Regierungsdekret als christlich-islamischen Staatsfeiertag erklärt. Jährlich kommen die Notablen der beiden Religionen in der in der Jesuitenkirche bei Beirut zur Feier der Menschwerdung Jesu durch das Jawort der Jungfrau zusammen. Dass Maria (arabisch Maryam) sich als Vermittlerin zwischen Christen und Muslimen empfiehlt, ist schon im Koran begründet. Sie gehört im Islam zu den am meisten verehrten Frauen. Im Koran tritt sie hervor als Modell für weibliche Frömmigkeit, Mutterschaft und bedingungslose Unterwerfung unter den Willen Gottes. Im Koran ist eine eigene Sure (19) nach ihr benannt.
Auch unter Juden wirkt Maria als Mittlerin zu Jesus. Am bekanntesten ist der elsässische Jude Alfonse Ratisbonne, der durch eine Marienerscheinung 1842 wie Paulus auf einen Schlag zum Eiferer und Zeugen Jesu für sein Volk wurde. Siehe auch Edith Stein, die als Jüdin und Christin ihr Leben für ihr Volk hingab mit dem Wort an ihre Schwester: „Komm, wir gehen für unser Volk!“
Der amerikanische Jude Roy H. Schoeman wurde durch Maria auf dramatische Weise, ohne Einfluss von Christen, zu Jesus geführt. Er widmet sein Buch: „Das Heil kommt von den Juden – Gottes Plan für sein Volk“ (St. Ulrich-Verl. Augsburg 2007) der jüdischen Mutter: „In Liebe und Dankbarkeit widme ich dieses Buch dem grössten Geschenk, das Gott (abgesehen von sich selbst) je der Menschheit machte: dem jungen jüdischen Mädchen, die als allererste Jesus erkannte und als den immerjüdischen Messias willkommen hiess – der jüdischen Mutter, die mich zu ihrem Sohn führte, der seligen Jungfrau Maria.“
In der Nachfolge der aufgehobenen „Amici Israel“ (s.o. Kap. 20) möchten wir uns im „Obergemach“ versammeln, zusammen mit „Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern (den Juden)“ (Apg 1,14) in der Erwartung eines „neuen Pfingsten“. Dazu das Gebet von Papst Johannes XXIII. zur Vorbereitung „seines“ Konzils:
„Erneuere in unserer Zeit das wunderbare Pfingstgeschehen und gewähre, dass die heilige Kirche, in einmütigem Gebet um Maria, die Mutter Jesu, geschart und von Petrus geführt, in einem neuen Pfingstwehen das Reich des göttlichen Erlösers ausbreite...“
Dies beten wir in der Erwartung eines „neuen Jerusalemkonzils“ (nach dem Leitbild von TJC-II, s.o. Kap. 17), wo die durch alle Konfessionen hindurchgehende scharfe, den Frieden blockierende Scheidung hinsichtlich der Berufung Israels (vgl. Jes 8,14; Lk 2,34f; 20,17f; Kap. 2) unter dem Wehen des Pfingstgeistes geheilt wird, „vereint mit Maria, der (jüdischen) Mutter Jesu und mit seinen (jüdischen) Brüdern“ (Apg 1,14). Dann wird man in ökumenischer Einheit verkünden: „Der Heilige Geist und wir haben beschlossen…“ (Apg 15,28).
Ein Bild als Schlussbotschaft
Die beiden, im selben „Obergemach“ beheimateten Leitbilder, sind in der abschliessenden Buchminiatur in einem Bild verbunden: 1. die Abendmahlsszene, wo Jesus rund um die zwölf Repräsentanten des erneuerten Zwölfstämmevolkes alle Völker an seinen Tisch mit dem einen Brot, das er selber ist, zum einen Gottesvolk verbindet, und 2. die Pfingstgemeinde mit Maria in der Mitte, welche die Jünger und Jüngerinnen rund um Jesus versammelt und für den Empfang des Pfingstgeistes vorbereitet, damit Jesus, den sie durch Überschattung des Heiligen Geistes mit ihrem Jawort empfangen hat, weiter in den Herzen der Menschen Gestalt annehme. Diese doppelte Herabkunft des Heiligen Geistes ist auf der Miniatur feinsinnig so angedeutet, dass die Geisttaube, die in Nazaret auf Maria herabkam, nun die runde Hostie mit ihrem Schnabel auf den runden Abendmahlstisch herabträgt. Von der Hostie aus verbindet Jesus mit den Strahlen des Heiligen Geistes die Jünger (seine Kirche) zu „einem Leib“ (1 Kor 10,16f). Das Rot der Strahlen weist hin sowohl auf die Feuerzungen des Heiligen Geistes wie auf das Blut aus der Seite Jesu.
Diese Doppelszene mit dem Abendmahl und der pfingstlichen Geistausgiessung wird sich vollenden mit der Völkerwallfahrt auf den Berg Zion (Jes 2,1-5), wo „der Herr der Heerscharen allen Völkern ein Festmahl zubereiten wird mit feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen. Er zerreisst auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott der Herr wischt ab die Tränen von jedem Gesicht“ (Jes 25,6-8), was mit etlichen Anspielungen hinweist auf den Abschluss der biblischen Offenbarung im neuen Jerusalem der Johannesoffenbarung (Offb 20f). Schon beim letzten Abendmahl blickt Jesus auf die endzeitliche Erfüllung: „Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes“ (Mk 14,25 Par.). „Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn bis er kommt“ (1 Kor 11,26).
Dieses Leitbild scheint himmelweit entfernt von den Ausweglosigkeiten mit der Zweistaatenlösung und dem Nahostkonflikt. Und doch liegt hier der Schlüssel einer nachhaltigen Lösung, nämlich indem wir uns verbinden mit Jesus, der sich als „König der Juden“ am Kreuz dem Vater hingegeben hat im Verlangen, „damit sie eins sind, wie wir ein sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast.“ So macht er uns zu Mitarbeitern seines Friedens, zu Brückenbauern zwischen dem Volk (Gottes) und den (zugewanderten) Völkern.
Wer von dieser Hoffnungsvision erfüllt ist, wird nicht dem Klagen und Anklagen kurzsichtiger „Friedensaktivisten“ mit ihrer „Zweistaatenlösung“ verfallen, sondern konkrete Schritte finden, jetzt schon mitzubauen an der „völkerverbindenden Gottesstadt“, der „Wohnung Gottes bei den Menschen, wo er abwischen wird jede Träne von ihren Augen“ (Offb 21,3f). So tat es beispielweise der Dominikanerpriester Bruno Hussar aus jüdischer Herkunft mit seiner Gründung „Neve Shalom – Oase des Friedens“, wo Juden, Muslime und Christen als Modell für Versöhnung und Frieden zusammenleben. [68]
[2] Ein Portal dafür: www.gatestoneinstitute.com.
[3] .Er schreibt mir: „Wie du dir vorstellen kannst, habe ich mit deiner Hermeneutik nicht ganz unbedeutende Probleme.
[4] Deutsch: Exodus Verlag, Fribourg/Brig, 1990. Noch schärfer sein neustes Buch: „A Palestinian Christian Cry for Reconciliation“ (2008).
[5] The Jerusalem Post – July 26, 2011
[6] Die andere mögliche Übersetzung „Keine Weissagung der Schrift verdankt sich menschlicher Anschauung“ ist weniger sinnvoll, weil eine Tautologie zum nachfolgenden Vers, und nimmt dem Satz die imperative Kraft. Der Brief will vor Irrlehrern warnen, welche die Schrift „eigenmächtig auslegen“ und nicht im Einklang mit der ekklesia.
[7] Sonderausgabe Herder-Verlag Freiburg 2003, 2 Bde. Originalausgabe „Biblical Theology of the Old and New Testament. Theological Reflexion on the Christian Bible”, London 1992.
[8] Man muss unterscheiden. Die Israelis haben kein fremdes Staatsgebiet erobert, sondern sich auf dem ehemaligen britischen Mandatsgebiet nach Völkerrechtsbeschluss niedergelassen mit ausdrücklicher Einladung an die Einheimischen, demokratisch mit ihnen zusammenzugehen. Vieles war Staatsland. Das Privatbodenrecht war kompliziert und kann nicht überall nachgewiesen werden. Schon lange vor der Staatsgründung hatten die Juden viel Land aufgekauft. Freilich gab es infolge der aufgezwungenen Kriegssituation schmerzhafte Vertreibungen. Modell (nebst den galiläischen Dörfern) ist Ein Kerem (Stadt Johannes des Täufers, Lk 1,39): vor 1948 war es ganz arabisch, nachher ganz jüdisch. Die Araber hätten ihre Häuser behalten, wenn sie dem Teilungsplan zugestimmt hätten. Dieser Ort hätte dann zum internationalisierten Gebiet rund um Jerusalem gehört.
[9] „’Catholics for Palestine’ and ‘Catholics for Israel’. The Israeli-Palestinian Conflict and the Catholic Church », aus www.catholicsforisrael.com.
[10] Z.B. der palästinensisch-christliche Staatsrechtler Sami Aldeeb, ehemaliger Verantwortlicher am Eidgenössischen Institut für Rechtsvergleichung in Lausanne.
[11] Zur rechtlichen Seite des Siedlungsbaus siehe Kap. 21
[12] www.palaestina-portal.eu , 20. Juni 2015
[13] Wie mir der damalige Berater der französischen Bischöfe, Kurt Hruby, persönlich sagte.
[14] Walter Kickel im Buch: „Das Gelobte Land. Die religiöse Bedeutung des Staates Israel in jüdischer und christlicher Sicht“, München 1984, S.131.
[15] Das schliesst nicht aus, dass die Juden nicht auch Demonstrationsvolk Gottes im Bestraftwerden sind wie der jesusgläubige Jude Arthur Katz in seinem Buch „Der Holocaust. Wo war Gott?“ (Verlag Ingo Schreurs, Düsseldorf 2000) darstellt. Er sieht den Holocaust bereits in Dtn 28,58-68 u.a. realistisch vorausgezeichnet.
[16] Beispielhaft für diesen « neuen Blick » ist Jean Dujardin mit seinem Quellenwerk : „L’Eglise Catholique et le Peuple Juif. Un autre regard“, Calman-Lévy, Paris 2003. In dieser kommentierten Dokumentensammlung lässt er die Aussagen von Johannes-Paul II. besonders aufleuchten.
[17] Im Büchlein „Der erneuerte Bund. Gottes Weg mit Israel“, Hrsg. v. Christoph Joest im Präsenz-Verlag, S.5
[18] Hubert Prolongeau, Le curé de Nazareth, Albin Michel, Paris 1998, S. 25. PHS: „Es ist inzwischen vielfach belegt, dass Tausende von Palästinensern auch von jüdischer Seite planmässig vertrieben wurden.“
[19] Georges Weisz: „Theodor Herzl – Une Nouvelle Lecture“ (L’Harmattan, Paris 2006). Herzl’s Mentor war der anglikanische Botschaftsgeistliche William Hechler, der ihn mit der biblischen Motivierung unterstützte. So war die Staatsgründung von Anfang an keine bloss nationalistisch-politische Angelegenheit, sondern spürbar von oben gelenkt.
[20] Diese Information aus www.salamshalom-ev.de
[21] Michael J. Pragai im Buch: „Sie sollen wieder wohnen in ihrem Land. Die Rolle von Christen bei der Heimkehr der Juden ins Land Israel“ (Gerlingen, Bleicher-Verlag 1990).
[23] International Christian Embassy Jerusalem
[24] So der ehemalige israelische Militärsprecher Avi Lipkin / Victor Mordecai in seinem Buch: „Christian Revival for Israel’s Survival“, was sinngemäss bedeutet: Israel kann nur überleben dank einer Erweckung, einem „neuen Pfingsten“ in der Christenheit. Dieser Autor kennt auch die Gefahr des Islam durch seine in Ägypten in arabischem Milieu aufgewachsene jüdische Frau. Er erkannte, dass die Gefahr des Islam im Heiligen Land nur gebannt werden kann, wenn Juden und Christen auf der Basis der Heiligen Schrift zusammenstehen, wobei er auch das Neue Testament für Juden als unverzichtbar hält. Dazu sein Buch: „Der Islam – Eine globale Bedrohung?“ (Hänssler 1999), wofür er in der Schweiz Redeverbot erhielt.
[25] Siehe den Bericht von Nicolas Dreyer vom 17.8.2015 im „Israelnetz“ von Johannes Gerloff.
[26] Dazu mein Buchbeitrag „Juden und Christen in gemeinsamer Mission – Judenmission oder gegenseitiges Zeugnis“, im Buch „Geistgewirkt – Geistbewegt“. Siehe Anm. 58.
[27] Wie Norman G. Finkelstein und Mark Braverman, deren Aussagen ich ausführlich kommentiert habe.
[28] Diese Klarstellung von Malcolm Lowe aus New English Review, deutsch in www.catholicsforisrael.com
[29] Siehe Klaus Wengst in: “Land Israel und universales Heil im Neuen Testament”, www.compass-infodienst.de . – Siehe auch ideaSpektrum 6/2014, S.15
[30] www.deutscher-koordinierungsrat.de . - Italienische Ausgabe: „Kairós Palestina – un momento di verità“, Edizioni Terra Santa, Milano.
[31] „Heiliges Land“, 2015/2, S. 9 (Organ des Schweizerischen Heiligland-Vereins)
[32] Darüber mein privat erhältlicher Artikel: „F.W. Foerster - prophetischer Rufer zur ‚jüdischen Frage’“
[33] Das ist auch die Bitte des Karfreitagsgebetes von Papst Paul VI. (1970): „Gott bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will… Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast: Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelangt…“
[34] Aus Pressemappe von Pax Christi zum Studientag über den israelisch-palästinensischen Konflikt am 26. Sept. 2015 in München.
[35] Yale University Press, London 2011, 342 Seiten. Präsentiert von Heinrich Mätzke in www.bayernkurier.de.
[36] Nach Michael Wolffsohn („Wem gehört das Heilige Land? Die Wurzeln des Streites…“, Piper 2002) flohen rund 1/3 der Flüchtlinge spontan aus Angst, 1/3, weil sie von den Israelis vertrieben wurden und 1/3, weil sie von der arabischen Armee dazu aufgefordert wurden mit der Versicherung, es sei zu ihrer eigenen Sicherheit; sie könnten wieder zurückkehren, wenn die Israeli ins Meer geworfen seien.
[37] In „Prophetisches Bulletin“ 2/2015, dem Organ der „Stiftung Schleife“ in Winterthur/CH
[38] Jes 7,14; 9,5f; 11,1ff¸42,6; 53,10ff; 60-62
[39] Dazu aus islamischen Geschichtsquellen: Adelgunde Mertensacker „Geführt von Dämonen. Mohammed im Urteil seiner Zeitgenossen“, Verl. Christliche Mitte, Lippstadt 1993. Noch deutlicher zeichnet aus den Quellen den dämonischen Hintergrund der Islamwissenschaftler Fouad Adel in seinen Schriften. Er schreibt: „Satan lässt sich als allmächtigen und allerlistigsten Allah von den Muslimen anbetend verehren. Er schreibt die Geschichte des Islam mit Blut, Terror und Verbrechen. Blut soll vergossen werden, bis der Islam die Weltherrschaft besitzt.“
[40] Salpe-Verlag 2011
[41] In: factum 9/2012
[42] Aus dem Bericht von Thomas Lachenmaier „Wir sollten für Zion beten“, in „factum“, 8/13, www.factum-magazin.ch. – Allerdings ist Palazzi nicht von allen Muslimen akzeptiert, „eine in vielen Bereichen sehr umstrittene Figur“ (PJS). Er vertritt einen liebenswürdigen, christenfreundlichen Islam.
[43] Nachrichten aus Israel, Jerusalem, Juni 1999.
[44] http://www.catholicsforisrael.com/de/artikel/israel-und-die-kirche/100-christ-the-glory-of-israel
[45] Jer 8,13; Mi 7,1; Joel 1,7
[46] Vgl. Lk 21,32 mit Jes 55,11 im Kontext mit der „Wiederherstellung Israels"
[47] Einen Überblick über diese Bewegung in Israel bietet: Hanna Rucks: „Messianische Juden. Geschichte und Theologie der Bewegung in Israel“, Neukirchener Verlagsgesellschaft 2014 (Doktorarbeit über 550 Seiten).
[49] Der Vatikan unterhält Gespräche auch mit messianischen Gruppen, die nicht zur TJC-II gehören. Diese vertritt nicht die ganze messianische Bewegung.
[50] Benjamin und Ruben Berger: “Der Weg – Der gute Weg unseres Lebens mit Jeschua im Land Israel“, echad-Verlag 2010
[51] Wertvolles über jüdische Identität finden wir in den Schriften messianischer Juden, u.a. bei Benjamin Berger
[52] Siehe darüber meine „Kritischen Überlegungen zur Nahostsynode“ (4 Seiten), bei mir elektronisch anzufordern.
[53] Freiburger Rundbrief 4/2021, S. 283.
[54] www.zenit.org . Siehe die bei mir zu beziehenden kritischen Überlegungen zur Nahostsynode.
[55] Kath. Wochenzeitung, 11/2014
[56] „The Challenges of the Pentecostal, Charismatic and Messianic Jewish Movements. The Tensions of the Spirit”, 2009, Ashgate Publishing Limited, Surrey, England.
[57] So der Titel seines Buches im Verlag D&D, 1996
[58] Molden/Wien 1998
[59] GGE-Verlag Hamburg 2010. Herausgegeben von Marie-Sophie Lobkowicz, mit Beiträgen von 15 katholischen, evangelischen und messianischen Autoren rund um die Bewegung TJC-II. Siehe Anm. 26
[60] Dazu fragt PJS: „Ist das so eindeutig zu erfassen? Gibt die Bibel hier eine eindeutige Antwort?“ Gewiss gibt die Bibel keine Antwort auf zeitbedingte Vorgehensfragen. Dazu hat Jesus den Heiligen Geist verheissen, der seiner Kirche im jeweiligen Kairos den Weg zeigt. Doch eindeutig zeigt die Bibel und das Konzil, wie das grösste Hindernis zum Frieden auszuräumen ist, nämlich durch die bei vielen noch fällige „Bekehrung zu Israel“ im Verständnis von Pater Raniero Cantalamessa (s.o. Kap. 16).
[61] Zur Israelfeindlichkeit des Ökumenischen Rates der Kirchen haben die beiden Israeltheologen Prof. Wolfgang und Ekkehard Stegemann eine ausführliche Aufschlüsselung geschrieben unter dem Titel: „Von Ambivalenz zur Feindschaft. Anmerkungen zum Verhältnis des Ökum. Rats der Kirchen zum Staat Israel“, www.kirche-und-israel.de.
[62] Stuttgart (Kohlhammer) 2014 – Dieses grundlegende Buch zeigt, wie die „Judenerklärung“ des Konzils in den Konsequenzen von weiten katholischen Kreisen nicht „rezipiert“ wurde. Darüber mein ausführlicher Kommentar unter dem Titel: „Der Kampf um die ‚Judenerklärung’ geht weiter“.
[63] Die Landweggabe weckte den Palästinensern den Eindruck: „Jetzt werden die Israelis schwach, jetzt können wir weiter vorangehen, um ‚unser Land’ zurückzuerobern“. Unter israelischer Oberherrschaft ging es den Bewohnern von Gaza bedeutend besser.
[64] Siehe Gerloff im Artikel „Recht, aber nicht billig“ in Israelnetz Magazin 5/2015
[65] In der Textvariante „zu mir“ stellt sich Gott selber hinter den für das Volk sühnenden Leidensknecht.
[66] Echad-Verlag CH-3367 Thörigen 2005 – Der Mann der Autorin leitet in Jerusalem eine messianische Gemeinde russischer Einwanderer.
[67] Zur weiteren Begründung dieser angedeuteten biblischen Mariologie ist bei mir einiges erhältlich. Z.B. über die Rolle Marias als Vermittlerin zwischen Christen, Juden und Muslimen.
